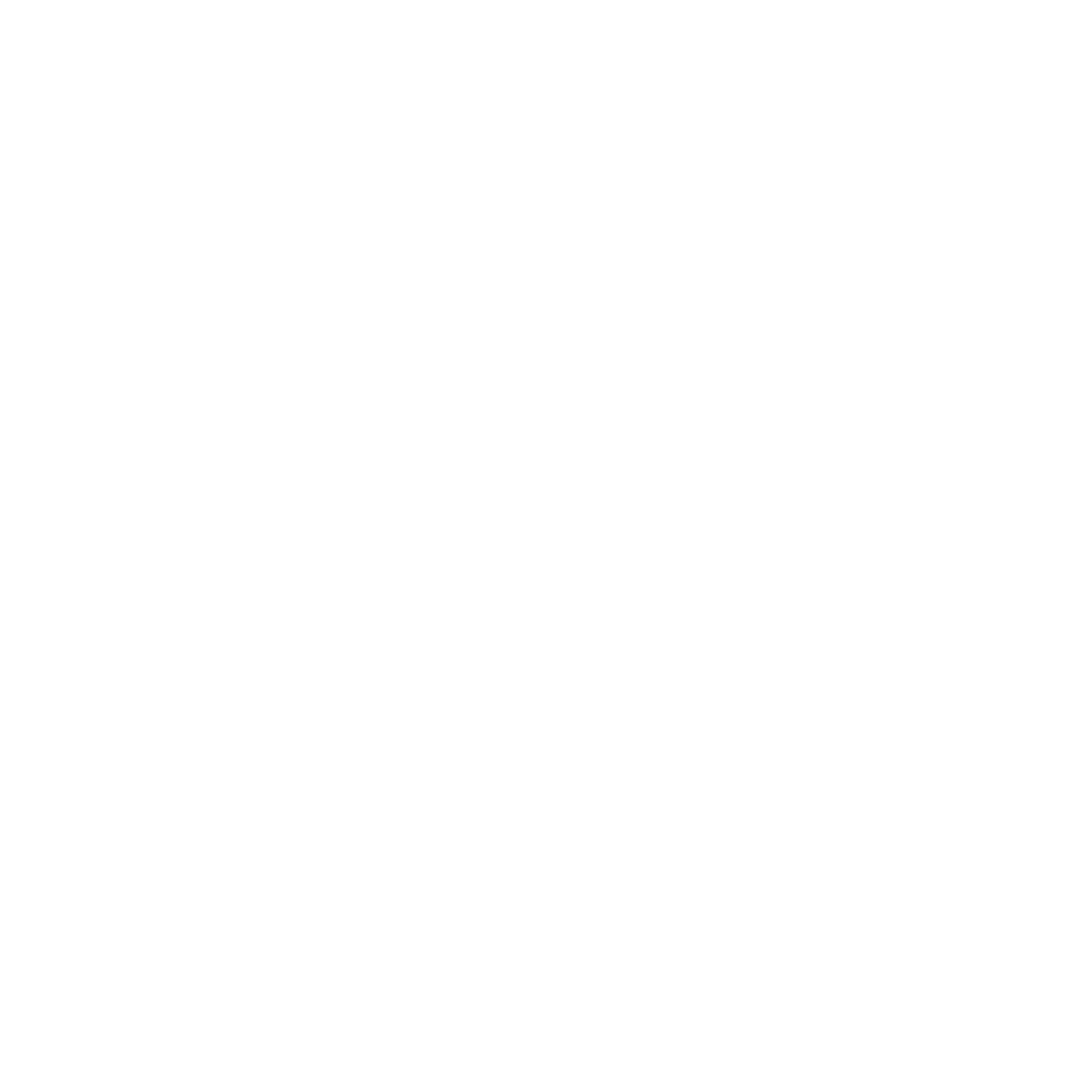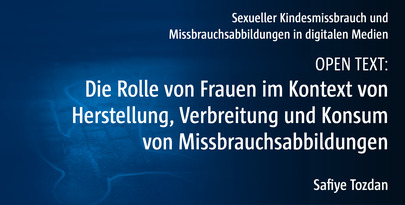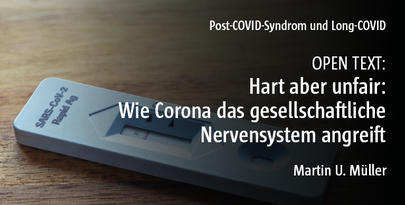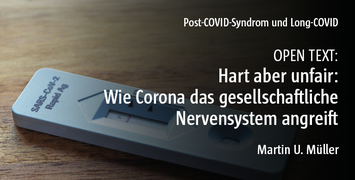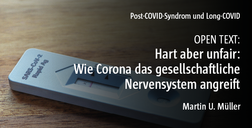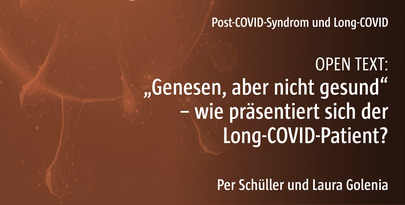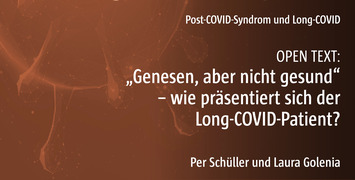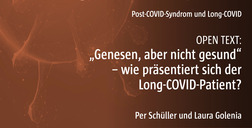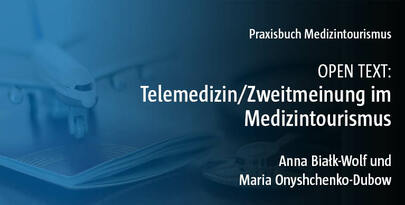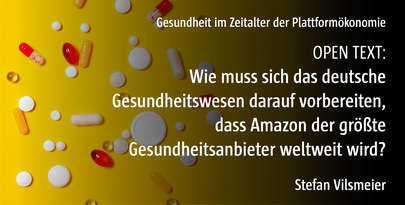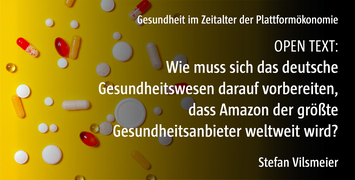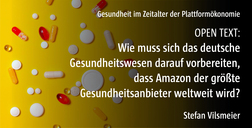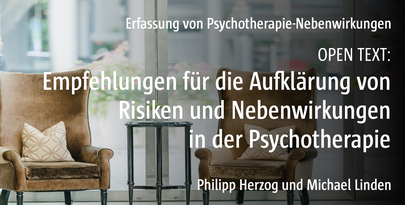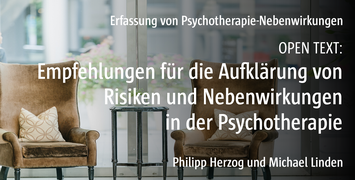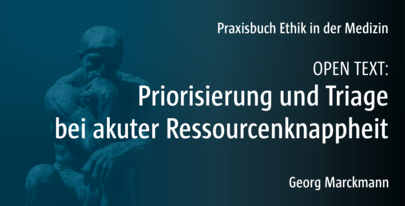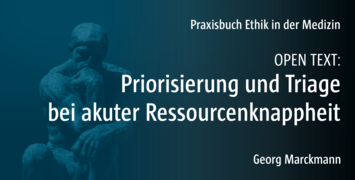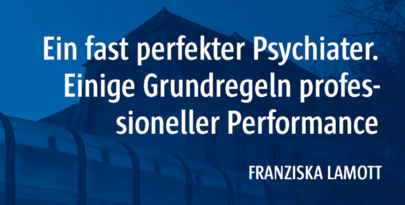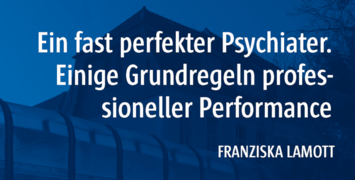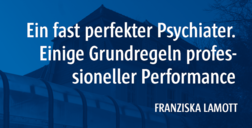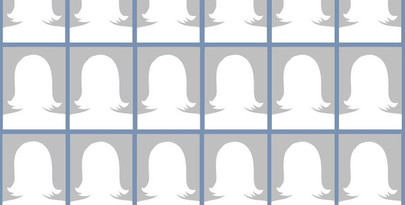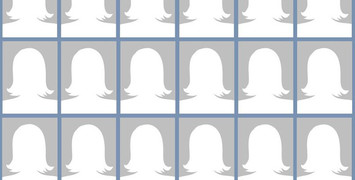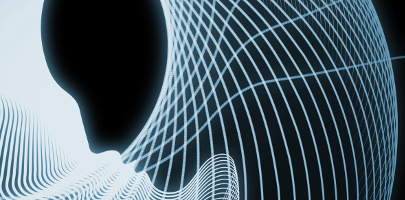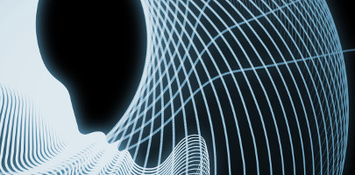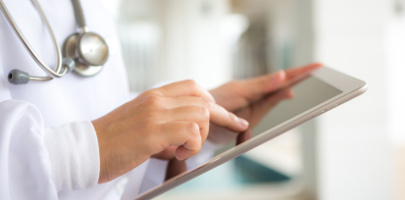Smart Hospital und das Corona-Virus
Hilft Digitalisierung auch bei einer Pandemie?
JOCHEN A. WERNER UND ACHIM STRUCHHOLZ
Die Bekämpfung des Corona-Virus hat auch Deutschland im Griff. Bislang in der Geschichte der Bundesrepublik nicht erlebte Eingriffe in das öffentliche und wirtschaftliche Leben haben zum Ziel, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Die Leistungserbringer,vor allem die niedergelassenen Ärzte und die Kliniken, werden mit bislang nicht dagewesenen Herausforderungen konfrontiert. Das reichte von der Bereitstellung der erforderlichen Schutzkleidung über die Planung und Vorhaltung von Intensivkapazitäten bis hin zur zentralen Frage, wie der notwendige Personalbestand vorgehalten werden kann.
Diese Ausnahmesituation hat die Stärken und Schwächen des deutschen Gesundheitssystems schonungslos offenbart. Und vor allem zu einer Erkenntnis geführt: Die Idee des Smart Hospitals ist nicht nur eine Strategie für den Regelbetrieb. Das Smart Hospital entfaltet seine volle Wirksamkeit auch und gerade in Krisenzeiten.
Drei zentrale Erkenntnisse aus der Bekämpfung des Corona-Virus
Die Infrastruktur des Gesundheitssystems limitiert dessen Leistungsfähigkeit
In Deutschland verfügen wir über hervorragend ausgebildete und motivierte Ärzte und Pflegekräfte sowie eine vergleichsweise hohe Anzahl an Intensivbetten. Die Basis des Gesundheitssystems ist – auch im internationalen Vergleich – sehr gut. Hinzu kommt ein nicht reglementierter Zugang aller Bevölkerungsgruppen zu den Leistungen eines solidarisch finanzierten Systems. Dies ist gerade in Krisenzeiten ein nicht zu unterschätzender Wert und unterscheidet uns maßgeblich z.B. von den USA.
Die Corona-Krise war und ist allumfassend. Das heißt, nicht nur die eigentlichen Leistungserbringer, sondern auch staatliche und kommunale Behörden, die Gesundheitsämter, Wissenschaftler, Forschungsinstitute und viele mehr sind involviert. Die Corona-Krise hat allerdings auch gezeigt, dass das deutsche Gesundheitssystem in weiten Teilen ineffi-zient, zu träge und zu wenig verzahnt arbeitet.
Das betrifft zum einen die jeden Tag in der Universitätsmedizin Essen spürbaren hohen Reibungsverluste bei der Betreuung unserer Patienten im Austausch mit den anderen Akteuren im Gesundheitswesen. Häufig werden Informationen zu Patienten noch per Fax übermittelt, das in der übrigen (Wirtschafts-)welt ausgestorben ist. Diese Informationen müssen dann von Hand aufbereitet bzw. in unser KISS-System übertragen werden. Fast täglich traten Probleme bei der Verlegung oder der Aufnahme von Patienten auf, weil beispielsweise Datensätze doppelt geführt wurden, ganz oder teilweise fehlten und es viel Mühe bereitete, diese Informationen in unsere eigene elektronische Patientenakte zu überführen. Die Vielschichtigkeit und Nicht-Kompatibilität von medizinischen Daten war ein großes Problem.
Nicht nur im originären medizinischen Sektor, auch bei der übergeordneten Logistik und insbesondere im Austausch mit den Bundes- und Landesbehörden waren die Verzahnungsdefizite unübersehbar. Bei jeder privaten Paketsendung wissen heute Absender und Empfänger, wo sich das Paket gerade befindet und wann es voraussichtlich zugestellt wird. Bei zentralen Fragen der Daseinsvorsorge wie der Ausstattung mit notwendiger Schutzkleidung hingegen herrschten bezüglich Verantwortlichkeit, Verfügbarkeit und Lieferfristen große Verwirrung. Davon waren auch wir als Universi-tätsmedizin unmittelbar betroffen – viel mehr aber noch die niedergelassenen Ärzte oder Pflegeeinrichtungen, die nicht über eine ähnlich hohe Einkaufsmacht verfügen und daher in besonderem Maße von der Versorgung durch staatliche Stellen abhängig waren.
Der Mangel an medizinischem (Pflege-)Personal verhindert das Ausschöpfen der Kapazitäten
In Deutschland verfügen wir über rund 28.000 Intensivbetten, eine hohe Anzahl im internationalen Vergleich. Während der Krise wurde häufig gefordert, diese Intensivbetten aufzustocken. Ein auf den ersten Blick plausibler Vorschlag. Allerdings nutzt die reine Erhöhung der Bettenzahl wenig. Zum einen benötigen Intensivbetten eine umgebende Infrastruktur inklusive baulicher Mindestanforderungen, um Paienten tatsächlich auf höchstem Niveau versorgen zu können. Zum zweiten – und dies ist der zentrale Punkt – müssen Intensivbetten durch entsprechende Fachkräfte bepflegt und natürlich ärztlich adäquat betreut werden. Pflegekräfte im Intensivbereich können – anders als etwa in der Altenpflege – nicht in Schnellkursen angelernt werden, sondern benötigen eine fundierte Ausbildung und Erfahrung. Der seit langem bekannte Pflegenotstand an hochqualifiziertem Personal, der im Regelbetrieb durch große Kraftanstrengungen teilweise noch kaschiert werden kann, wurde in der Bekämpfung der Corona-Krise in großer Deutlichkeit offenbar.
Während der Pandemie erkrankten natürlich auch Ärzte und Pflegekräfte, die in der Versorgung der Patienten fehlten. Daher verlagerte sich der Fokus aller internen Maßnahmen auf die Erfordernis, das medizinische Personal zu schützen, gleichzeitig aber auch einsatzfähig zu halten. Das spiegelte sich auch an den sich tagesaktuell ändernden Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts wieder, die zunehmend darauf abzielten, symptomfreien Mitarbeitern das Arbeiten zu ermöglichen, anstatt lange häusliche Quarantänen vorzuschreiben. Dieser gleichsam erzwungene Pragmatismus hat seinen Ursprung eben auch im Fehlen von qualifiziertem Personal und an der mangelnden Einhaltung vorhandener oder nicht-adäquater vorhandener Pandemiepläne. Auch die unternommenen Aktivitäten zur Reaktivierung von pflegerischem und medizinischem Personal waren löblich, konnten allerdings die strukturellen Defizite nicht wirklich kompensieren.
Was relevant zu Tage trat, waren unzureichende Hygieneschulungen im Bereich der Altenpflege. Hier werden künftig gemeinsame Ausbildungsstränge, aber auch digital unterstütztes kontinuierliches Lernen Optimierung erlauben.
Wesentliche Lieferketten der medizinischen Grundversorgung sind längst globalisiert
Die Corona-Krise hat gezeigt, dass vor allem medizinische Massenware, aber auch Grundstoffe für Medikamente schon längst nicht mehr in Deutschland oder Europa, sondern vor allem in China produziert werden. Das ist im Prinzip nicht ungewöhnlich, werden doch auch für viele andere Branchen zahlreiche Produkte in China hergestellt. Dass dies aber nicht nur für Konsumgüter, sondern auch für mitunter lebenswichtige medizinische Produkte gilt, hat in dieser Dimension manche Akteure im Gesundheitswesen scheinbar überrascht. Ausdruck davon war die Hilflosigkeit, mit der die Politik versucht hat, Schutzkleidung aufzutreiben, während die internationalen Märkte, explizit der besonders betroffene Markt China, längst leergekauft waren. Hier wird seitens der Politik sichergestellt werden müssen, zentrale medizinische Bedarfsmaterialien innerhalb Deutschlands oder Europas zu produzieren.
Die Schlussfolgerungen: Handlungsbedarf in zentralen Themenfeldern
Konzertierte Aktion zur Digitalisierung des Gesundheitswesens: #CHANCECORONA
Die von der Politik bereits angeschobene Digitalisierung des Gesundheitswesens muss mit erhöhter Geschwindigkeit vorangetrieben, Verfilzungen müssen endlich aufgebrochen werden. Das Momentum der Veränderung, getrieben von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate, darf nicht ungenutzt verstreichen. Jetzt ist die Zeit, die dringend notwendige Digitalisierung und Harmonisierung im Gesundheitswesen umzusetzen. Davon profitieren wir nicht nur in krisenhaften Ausnahmesituationen, sondern auch im Regelbetrieb. Dies betrifft auch das Austarieren behördlicher Auflagen und das Zurückstellen des Datenschutzes hinter die Belange der Krankenversorgung. In einer digitalisierten Medizinwelt wird es künftig bei einer Pandemie möglich sein, gestützt auf Algorithmen und Künstliche Intelligenz, den Materialverbrauch hochzurechnen, zu optimieren und sich signifikant besser als im Frühjahr 2020 darauf vorzubereiten. Das gilt für den Bedarf an Schutzkleidung, aber auch für Dinge wie digitalisierte Desinfektionsspender, die passgenau die notwendige Menge Flüssigkeit spenden und so dazu beitragen, notwendige Ressourcen zu schonen. Künstliche Intelligenz wird auch dabei helfen, den Charakter und die Biologie des Virus besser zu verstehen und hoffentlich bald einen Impfstoff zu entwickeln. Dank Telemedizin lassen sich bereits erkrankte und in Quarantäne befindliche Patienten aus der Ferne betreuen – diesbezüglich haben wir wichtige Erfahrungen gesammelt. Auch Kommunikationswege, die nicht auf der physischen Präsenz der Teilnehmer basieren wie Web- und Telefonkonferenzen haben an Relevanz gewonnen. Sogar der Einsatz von Virtual und Augmented Reality ist in diesem Zusammenhang denkbar, um Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzuführen. Außerhalb des klinischen Bereiches sehen wir vor allem KI-gestützte Rechenmodelle, die die Verbreitung und das Ausbruchsverhalten von Krankheiten hochrechnen. Diese Aufzählung ließe sich fortsetzen. Letztlich aber kann Digitalisierung nicht aus der Politik befohlen werden. Die Unterstützung aller Akteure des Gesundheitswesens gehört untrennbar dazu.
Pflegenotstand entschlossen angehen
Nicht nur das Bereitstellen von Intensivkapazitäten, das notwendige medizinische Equipment inklusive Beatmungsgeräte sowie die erforderliche Schutzkleidung waren große Herausforderungen. Der engste Flaschenhals war die ärztliche und vor allem die pflegerische Betreuung. Insofern muss uns Corona eine Lehre sein, mit einer noch viel stärkeren Anstrengung als bisher den Pflegeberuf wieder attraktiv zu machen und die Pflegekräfte gut und umfassend auszubilden und durch Robotik und KI zu entlasten. Bei allem Engagement hat die Krise eben auch gezeigt, dass trotz großen persön-lichen und zeitlichen Einsatzes strukturelle Defizite nicht einfach durch Mehrarbeit kompensiert werden können. Auch die furchtbaren Bilder aus Italien und Spanien haben dies leider deutlich gemacht. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen – auch vor dem Hintergrund einer dramatisch verbesserten gesellschaftlichen Anerkennung – den Pflegeberuf wieder attraktiv zu machen. Eine adäquate Vergütung und Berücksichtigung im DRG-System sind dafür Grundvoraussetzung.
Lieferketten neu bewerten
Zu den positiven Erkenntnissen der Corona-Pandemie zählt zweifellos, dass die Politik das auch in der Medizin allumfassende „Made in China“ neu bewertet und infrage stellt. Insbesondere, weil fehlende Schutzausrüstungen wie Atemschutzmasken oder Face Shields nicht nur die unmittelbare Krankenversorgung betreffen, sondern auch für die Produktion von Medizinprodukten und Arzneimitteln benötigt werden. Hier muss von der Politik, aber auch allen nach-gelagerten Lieferanten in der Lieferkette neu festgelegt werden, wie weit die Abhängigkeit von einem Anbieter tatsächlich gehen darf. Aus unserer Sicht sind dazu auch höhere Kosten zugunsten einer gesicherten, von nationalen Interessen freien Grundversorgung tolerierbar, ja sogar angezeigt. Denn die Bedeutung fehlender Schutzausrüstung oder Medikamente hat eben letztlich doch eine andere Qualität als ein fehlendes Zubehörteil im Automobilbau.
Rolle der Universitätskliniken stärken
Während der Bekämpfung des Corona-Virus wurden Stimmen laut, auch Universitätskliniken sollten sich in der Phase der Krankheitsbewältigung ausschließlich auf die Versorgung von an Covid-19 erkrankten Patienten konzentrieren. Diese Forderung war grundfalsch. Zumeinen ist es die originäre Aufgabe der Universitätskliniken, Forschung zu betreiben und die dadurch gewonnenen Erkenntnisse zum Nutzen der Patienten in die Krankenversorgung zu übertragen. Hier kann man nicht warten, bis man in aller Ruhe weiterarbeiten kann. Zum anderen bietet doch gerade die Bekämpfung des Coronavirus eine einmalige Chance, in engem Austausch zwischen Forschung, Lehre und Krankenversorgung wesentliche medizinische Fortschritte zu machen. Wir waren und sind live in einem großen virologischen Ereignislabor, und es ist widersinnig, die dadurch gemachten Erfahrungen nicht für ein verbessertes Verständnis zur Biologie dieses Virus und für die Entwicklung von Medikamenten oder eines Impfstoffes zu nutzen. Das Institut für Virologie an der Universitätsmedizin Essen betreibt seit Jahren gemeinsam mit chinesischen Wissenschaftlern ein Labor für Virusforscher an der Universität Wuhan, unterstützt von der Provinzregierung Hubei. Bereits seit 1983 besteht eine Kooperation zwischen dem Universitätsklinikum Essen und dem Universitätsklinikum Wuhan. Vor diesem Hintergrund hat das Institut für Virologie als eine der führenden Forschungseinrichtungen und aufgrund des engen Austauschs mit unserer Klinik für Infektiologie eine zentrale Rolle bei der Entwicklung eines Wirk- bzw. Impfstoffs gegen den Erreger. Das ist nur ein Beispiel: Wir sollten die Expertise der Universitätskliniken nicht beschneiden, sondern in vollem Umfang nutzen. Eine aus-kömmliche Finanzierung ist dazu Grundvoraussetzung. Die Ereignisse um Corona zeigen, welch zentrale Bedeutung die Universitätsklinika in Deutschland bei der Bewältigung der Pandemie haben. Sie führen jedoch – und dies muss uns allen zu denken geben – in eine sich weiter zuspitzende Unterfinanzierung. Wenn sich Deutschland nicht endlich und mit aller Ehrlichkeit dazu bekennt, die Forschung im Gesundheitswesen an die erste Stelle der Prioritätenliste zu setzen, dann ist dies eine bewusste Entscheidung mit allen zu tragenden Konsequenzen. Die Gesundheit ist das größte Gut der Menschen, sie passiert nicht von selbst.
Zusammenfassung
Aus einer Krise gestärkt hervorgehen ist eine oftmals angewendete, aber häufig leider nicht zutreffende Redewendung. Die Medizin muss es besser machen, weil sie dazu alle Chancen hat. Wie unter dem Mikroskop hat der Umgang mit dem Corona-Virus unser Gesundheitssystem seziert. Die strukturellen Defizite sind offensichtlich, aber keines davon ist unlösbar. Die Sensibilität und die Bereitschaft für notwendige Änderungen im Gesundheitssystem ist hoch, Geld ist ebenso wie Expertise ausreichend vorhanden. Wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren, sondern müssen das Momentum nutzen, um unsere medizinische Versorgung digitaler, besser und menschlicher zu machen. Sind es heute noch die Virologen, die maßgeblich zur Problemlösung herangezogen wurden und werden, sind es künftig mehr und mehr die Datenwissenschaftler.
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Werk Smart Hospital, herausgegeben von Jochen A. Werner | Michael Forsting | Thorsten Kaatze | Andrea Schmidt-Rumposch.

 Health Care Management
Health Care Management