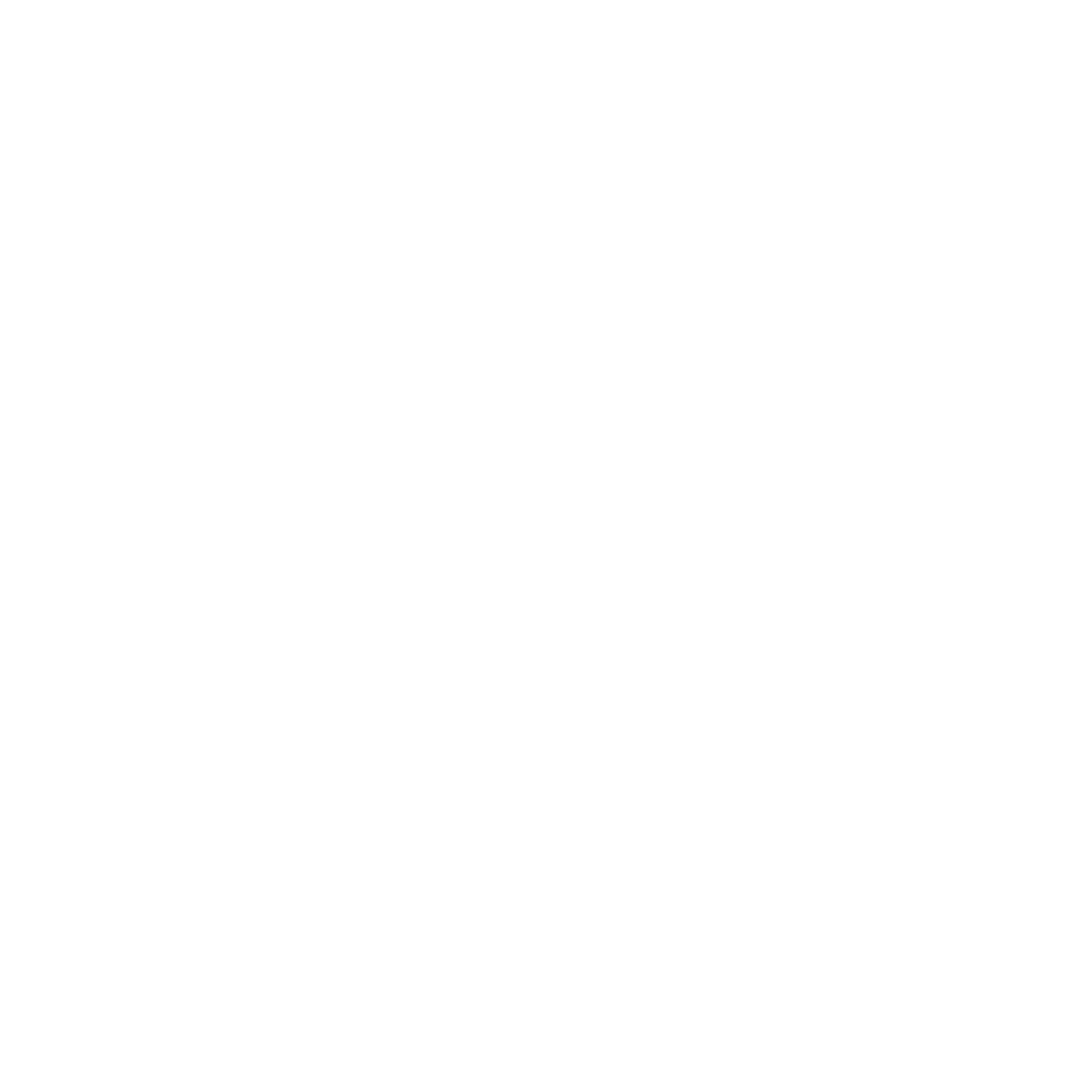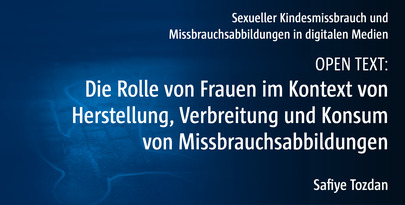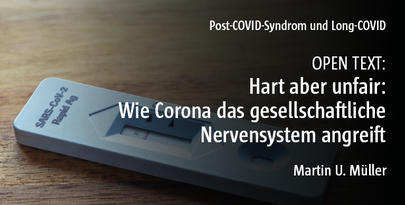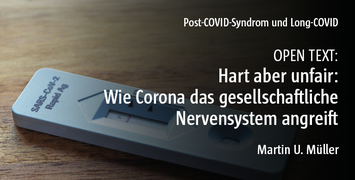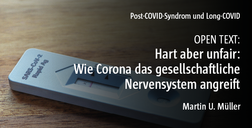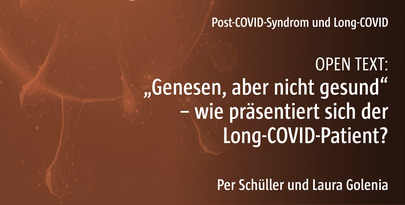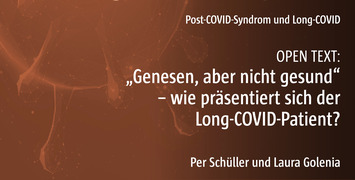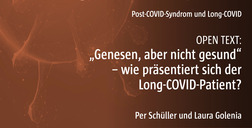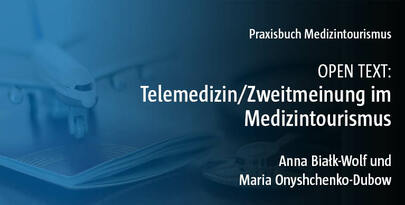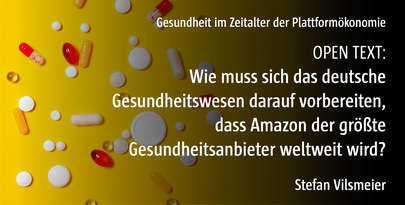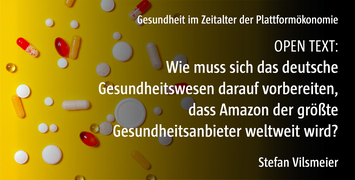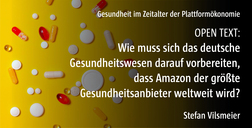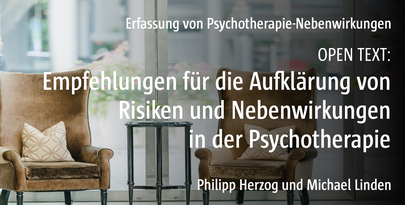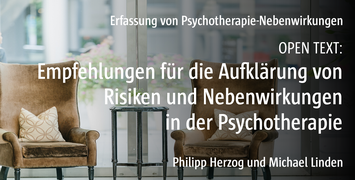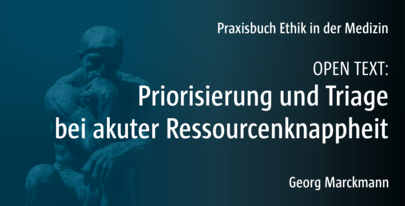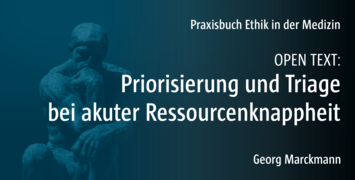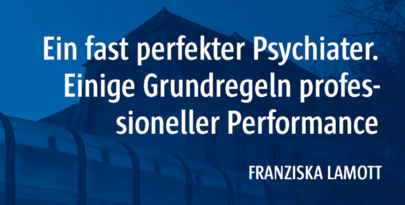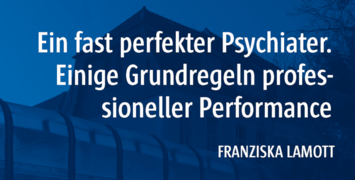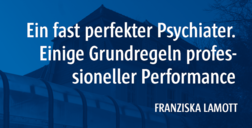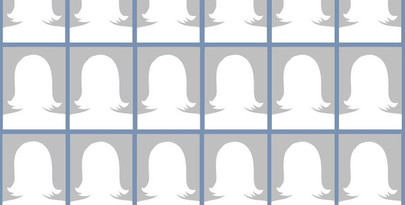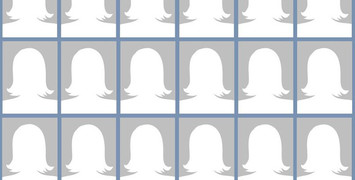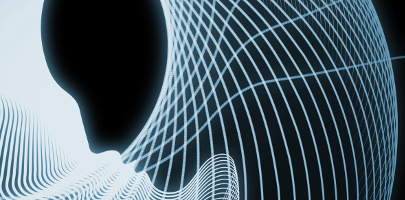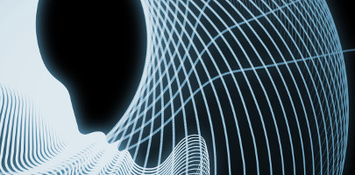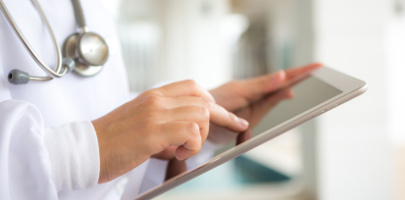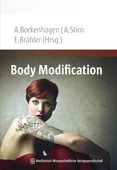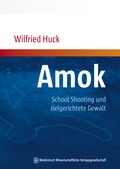Wer sollte Arzt werden und warum?
Wer sollte Arzt werden und warum?
SIGRID HARENDZA und FRANK ULRICH MONTGOMERY
Wer ist ein „guter“ Arzt?
Was erwarten wir als Patienten von einem „guten Arzt“? Er/sie soll uns zuhören, herausfinden, was uns fehlt, und uns wieder gesund machen. Und das möglichst schnell und freundlich, kompetent und fehlerfrei. Dass auch Krankheiten auftreten können, die nicht heilbar sind, dass Fehler in der Diagnostik und Behandlung passieren können und dass bei vielen medizinischen Entscheidungen Unsicherheit ausgehalten werden muss, ist meistens wenig präsent, wenn wir krank sind. Medizinstudierende antworteten auf die Frage, wie man ein „guter Arzt“ werde, dass man die richtige Balance von Altruismus und Selbstaufopferung finden müsse (Marynissen u. Spurrier 2018). Aber genügt das schon?
Eine Studie aus den USA ließ vermuten, dass bis zu 98.000 Todesfälle auf medizinische Fehlentscheidungen zurückzuführen waren (Mokdad et al. 2004). Fehlentscheidungen in der Medizin treten vorwiegend in zwei Kategorien auf: Fehler, bei denen standardisierte Prozeduren nicht befolgt werden, und Fehler, die aufgrund von allgemeinen kognitiven Irrtümern entstehen. Die Fehler der ersten Kategorie lassen sich erfolgreich durch den Einsatz von Checklisten reduzieren (Gawande 2009). Beispielsweise verbessert der Einsatz von Checklisten für Teamarbeit und Kommunikation im Operationssaal die Patientensicherheit (Russ et al. 2013). Die Fehler der zweiten Kategorie sind nicht leicht zu bemerken und erfordern für ihre Entdeckung systematisch geübten Selbstzweifel und das Wissen um diese Art von Fehlern. Beides steht im Medizinstudium in Deutschland bisher noch kaum auf dem Lernplan.
Unabhängig von der Fachrichtung verläuft das ärztliche Denken im Kontakt mit Patienten vom Symptom zur Diagnose, ein Prozess, der als Clinical Reasoning bezeichnet wird (Elstein et al. 1978) und nach den Prinzipien des schnellen und langsamen Denkens funktioniert (Kahneman 2011). Nach der Präsentation von Symptomen und Befunden führt der Weg des ärztlichen Denkens entweder durch Mustererkennung oder über das analytische Denken und das Heranziehen von Tests zur Diagnose (s. Abb. 1). Auf beiden Wegen lauern kognitive Denkfehler (Cooper 2017), die nicht nur in medizinischen Kontexten vorkommen (Dobelli 2011), in diesen jedoch zu Fehldiagnosen führen und Patienten gefährden können. Clinical Reasoning und der Umgang mit kognitiven Denkfehlern lassen sich zwar erlernen (Kassierer et al. 2010, Croskerry 2003), aber Aufmerksamkeit und Selbstreflexion abzurufen, durch die solche Fehler reduziert werden können (Scott 2009), gelingt nicht jedem in kritischen Situationen. Vielleicht wären Aufmerksamkeit und Selbstreflexion somit zwei wichtige Kriterien, die bei der Auswahl von Studienplatzbewerbern Berücksichtigung finden sollten?
Welche Kernkompetenzen brauchen Ärzte?
In einer Delphi-Befragung von Ärzten der Inneren Medizin und der Chirurgie an drei Hochschulstandorten in Deutschland fanden sich 10 von 25 Kernkompetenzen (s. Tab. 1), die für Berufsanfänger von beiden Gruppen als am wichtigsten bewertet wurden (Fürstenberg et al. 2017). Diese Kernkompetenzen werden nur zu einem geringen Teil im Medizinstudium explizit unterrichtet, lassen sich aber mit einem 360-Grad-Assessment, das einen ersten Arbeitstag im Krankenhaus simuliert, gut erfassen (Harendza et al. 2017b). Nach einer simulierten Sprechstunde folgte für die in der Arztrolle teilnehmenden Medizinstudierenden eine Phase des Patientenmanagements. In dieser Phase, in der es auch zu interprofessionellen Interaktionen und zur Priorisierung von Arbeitsschritten kam, die mit Unsicherheiten verbunden waren, fühlten sich die Medizinstudierenden am stärksten beansprucht (Fürstenberg et al. 2018). In der Kompetenz „Struktur, Arbeitsplanung und Dringlichkeit“ erhielten die Teilnehmenden gleichzeitig die niedrigsten Bewertungen (Prediger et al. 2018).
Die Studierenden, die an diesem 360-Grad-Assessment teilnahmen, absolvierten außerdem den Group Assessment of Performance (GAP) Test für Flugschulanwärter (Oubaid et al. 2012). Mit diesem computergestützten Testverfahren werden Personen in Dreier- oder Vierergruppen in Bezug auf die Ausprägung folgender Eigenschaften untersucht:
- Führung,
- Zusammenarbeit,
- Beanspruchbarkeit,
- Aufmerksamkeit,
- Kommunikation und
- Regelorientierung.
Die teilnehmenden Medizinstudierenden erreichten Spitzenwerte im Bereich Regelorientierung, während sie im Bereich Aufmerksamkeit im Mittel am schlechtesten abschnitten und nicht die Grenzwerte erreichten, die im DLR-Auswahlverfahren für die Aufnahme zur Ausbildung von Cockpitpersonal erforderlich sind (Harendzaet al. 2018). Ärzte aus fünf verschiedenen Fachrichtungen, die Kernkompetenzen benennen sollten, die sie für ihre jeweilige Fachrichtung als besonders wichtig erachteten, bewerteten Stressresistenz, Führung, Regelorientierung, Teamwork und Kommunikation als sehr relevant (Anheuser et al. 2017). Da diese genannten bzw. getesteten Kompetenzen für die ärztliche Tätigkeit so bedeutend sind wie für Piloten, stellt sich auch hier die Frage, ob sie bereits bei der Aufnahme ins Medizinstudium getestet werden sollten?
Wie lässt sich ein ärztliches Berufsprofil definieren?
Ist das Medizinstudium absolviert und die Approbation erreicht, stellt sich die Frage, welche – meist sechsjährige – ärztliche Weiterbildung die Absolventen einschlagen möchten. Hier bietet sich ein breites Spektrum von Allgemeinmedizin bis zu Radiologie, von Neurochirurgie bis zu Psychiatrie, von Pädiatrie bis zu Geriatrie. Für die verschiedenen Fachrichtungen lässt sich vermuten, dass neben den oben genannten Kernkompetenzen sehr unterschiedliche Persönlichkeits- und Tätigkeitsprofilanforderungen bestehen. Für Chirurgen ließ sich beispielsweise mithilfe des Trait-Trackers, einem ergänzenden Instrument zum Fleishman Job Analysis Survey (Kleinmann et al. 2010), ein umfassendes und spezifisches Kompetenzprofil für diese Fachrichtung darstellen (Oubaid u. Jähne 2013). Dies könnte bei der Auswahl von Bewerbern für eine chirurgische Weiterbildung eingesetzt werden. Auch für die Auswahl von Personal in der Fachrichtung Urologie konnte die Sinnhaftigkeit eines am Berufsprofil orientierten Auswahlverfahrens gezeigt werden (Oubaidu. Anheuser 2014).
Da die erforderlichen Persönlichkeitseigenschaften und die spezifischen ärztlichen Kompetenzen je nach Berufsprofil der ärztlichen Fachrichtung stark variieren, stellt sich die Frage, inwieweit es möglich ist, diese schon bei einem Auswahlverfahren für das Medizinstudium zu berücksichtigen oder auch nicht – da eine Hochschule vermutlich nicht nur Medizinstudierende ausbilden möchte, die später Chirurgen oder Psychiater werden. Denkbar wäre jedoch eine Selbsttestung der spezifischen Kompetenzen während der ersten Hälfte des Medizinstudiums. Damit könnten die Studierenden erkennen, für welche Fachrichtungen sie passende Kompetenzprofile aufweisen. Mit diesem Wissen könnten sie dann entweder ihre Talente für diese Fachrichtungen im Wahlpflichtbereich vertiefen und ausbauen,oder sich gezielt in Kompetenzen für andere Fachrichtungen weiterentwickeln.
Wie schafft man das Medizinstudium?
Für kompetentes Arbeiten als Arzt ist es jedoch zunächst eine Voraussetzung, dass man das sechsjährige Medizinstudium absolviert und die staatliche Ärztliche Prüfung besteht, da ohne Approbation kein ärztliches Arbeiten möglich ist. In Deutschland wurden seit der im Jahr 2004 erfolgten Novellierung des Hochschulrahmengesetzes (HRG) nach Abzug der Vorabquoten (z.B. für Härtefälle) 20% der Medizinstudienplätze an die Abiturbesten vergeben, 60% innerhalb gesetzlicher Vorgaben unter Berücksichtigung einer guten Abiturnote und zusätzlicher Auswahlkriterien der Hochschulen und 20% nach Wartezeit. Nationale und internationale Untersuchungen zeigen, dass eine exzellente Abiturnote ein guter Garant dafür ist, das mit Inhalten zum Auswendiglernen stark belastete Medizinstudium erfolgreich zu absolvieren und weniger häufig abzubrechen (Trapmann et al. 2007; Patterson et al. 2016).
Der von vielen medizinischen Fakultäten für die Studierendenauswahl eingesetzte Test für Medizinische Studiengänge (TMS) misst Merkfähigkeit, Genauigkeit visueller Wahrnehmung, räumliches Vorstellungsvermögen, sorgfältiges und konzentriertes Arbeiten sowie naturwissenschaftliches und medizinisches Problemverständnis. Mithilfe dieses Tests ließ sich zeigen, dass Medizinstudierende mit weniger exzellenten Abiturnoten, aber sehr guten TMS-Ergebnissen ähnlich gute Studienleistungen erzielten wie die Abiturbesten (Kadmon u. Kadmon 2016).
Mit einem an der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg entwickelten Test (HAM-Nat), der für das Medizinstudium relevante naturwissenschaftliche Kenntnisse auf dem Niveau der Schuloberstufe misst, lässt sich der Studienerfolg für die ersten beiden Studienjahre prognostizieren (Hissbach et al. 2011). Die Wahrscheinlichkeit, dass die durch Abiturnote, TMS oder HAM-Nat ausgewählten Medizinstudierenden das Studium erfolgreich beenden werden, scheint also gegeben. Einen Zusammenhang mit den für den Arztberuf erforderlichen Kompetenzen gibt es dadurch aber nicht zwingend. Ebenso ist bisher nicht bekannt, ob Studierende bereits vor Beginn eines Medizinstudiums über bestimmte psychosoziale Kompetenzen oder Persönlichkeitsmerkmale verfügen sollten oder ob sie sich solche während eines Medizinstudiums in einem entsprechend ausgerichteten Curriculum aneignen können.
Mit seinem Urteil vom 19. Dezember 2017 verpflichtet das Bundesverfassungsgericht nun die Hochschulen in Deutschland, Medizinstudienplätze zusätzlich zur Abiturnote nach einem „eignungsrelevanten Kriterium“ zu vergeben. Worin die „Eignungsrelevanz“ genau besteht, ist nicht detaillierter spezifiziert, aber auch eine medizinnahe berufliche Qualifikation oder soziale Faktoren dürften Berücksichtigung finden. Dieses Urteil bietet den Hochschulen die Chance, Kriterien für psychosoziale Kompetenzen zu definieren, die neben der Studierfähigkeit für die ärztliche Tätigkeit wesentlich sind, und diese zu testen.
Wie sollten Medizinstudierende ausgewählt werden?
Dass sich mithilfe der Abiturnote sowie durch kognitive oder naturwissenschaftliche Tests vorhersagen lässt, ob Medizinstudierende das Studium erfolgreich bewältigen werden, ist wissenschaftlich gut belegt (Trapmann et al. 2007; Patterson et al. 2016; Kadmon u. Kadmon 2016; Hissbach et al. 2011) und sollte daher bei der Auswahl von Medizinstudierenden zu einem gewissen Grad Berücksichtigung finden. Zusätzlich erscheinen Auswahlverfahren geeignet, die psychosoziale Kompetenzen oder weitere der oben genannten Kernkompetenzen für den ärztlichen Beruf erfassen können.
Das Testverfahren der sogenannten Multiplen Mini-Interviews (MMI) wurde vor über 10 Jahren an der kanadischen McMaster Universität entwickelt (Eva et al. 2004), um psychosoziale Kompetenzen bei Bewerbern für einen Medizinstudienplatz zu messen. Hierbei handelt es sich um einen Parcours mit mehreren Stationen, an denen die Teilnehmenden unterschiedliche Interviewaufgaben, Rollenspiele oder Gesprächssituationen bewältigen müssen, die von Juroren bewertet werden. Obwohl die MMIs Verhalten in kontextspezifischen Aufgaben erfassen, was Rückschlüsse auf andersartige Situationen erschwert, zeigen die meisten MMIs eine gute Generalisierbarkeit (Knorr u. Hissbach 2014). Ob die MMIs wirklich die Kernkompetenzen messen, die später in der ärztlichen Tätigkeit erwartet werden, ob die MMIs also eine gute Konstruktvalidität haben, ist bisher noch nicht abschließend geklärt.
Die sogenannten Situational Judgement Tests (SJT) sind ein weiteres Verfahren, welches zur Auswahl von Personal eingesetzt wird. Hierbei werden den Teilnehmenden in verschiedenen Formaten für Beruf oder Studium relevante Situationen vorgestellt,für die sie ohne Fachkenntnisse beantworten sollen, wie sie sich verhalten würden oder wie man sich verhalten sollte (McDaniel et al. 2007). Ein solcher SJT, mit dem Teamfähigkeit, Integrität und Perspektivübernahme gemessen werden, wird beispielsweise als Teil des Aufnahmeverfahrens für Medizinstudierende in Großbritannien eingesetzt (Patterson et al. 2017). An den Universitäten Heidelberg und Oldenburg werden interpersonelle Sozialkompetenzen mithilfe eines videobasierten SJTs, der gute Testparameter zeigt, bei Medizinstudienplatzbewerbern gemessen (Fröhlichet al. 2017). Ob die Testergebnisse eine gute Korrelation mit kompetentem Verhalten am Ende des Medizinstudiums zeigen, ist bisher nicht untersucht.
Bevor also MMIs, SJTs oder ein für ärztliche Tätigkeit modifizierter GAP-Test valide eingesetzt werden können, um Medizinstudierende mit Bezug auf ihre späteren Kompetenzen als Ärzte auszuwählen, sollte zunächst wissenschaftlich geklärt werden, ob mit solchen Tests ausgewählte Studierende am Ende ihres Studiums bzw. zu Beginn ihrer Berufstätigkeit in medizinischen Arbeitskontexten neben den erworbenen medizinischen Kenntnissen die gewünschten psychosozialen Kernkompetenzen auch wirklich aufweisen. Um dies zu überprüfen, wäre beispielsweise das oben beschriebene 360-Grad-Assessment geeignet, bei dem ein erster Arbeitstag simuliert wird und bei dem einige der erwünschten Kernkompetenzen gemessen werden (Harendzaet al. 2017b). Sollten sich in einem solchen Assessment bei Medizinstudierenden am Ende des Studiums bei gleicher medizinisch-inhaltlicher Qualität positive Korrelationen mit den psychosozialen Kompetenzen, die mit den genannten Auswahlverfahren getestet werden, zeigen, so wäre eine gute Konstruktvalidität der entsprechenden Tests hoch wahrscheinlich und ihr Einsatz für die Auswahl von Medizinstudierenden geeignet. Diese könnten damit genügend Aufmerksamkeit, Selbstreflexion und weitere Kompetenzen nachweisen, um Patientengefährdung zu reduzieren und mit Unsicherheit im ärztlichen Alltag umzugehen. Dass trotz Optimierung der Auswahlverfahren gleichzeitig weitere Entwicklungen der medizinischen Curricula erforderlich sind, um die Medizinstudierenden für die ärztlichen Anforderungen der Zukunft auszubilden und eine gute Patientenorientierung zu gewährleisten, sollte ebenso selbstverständlich sein.
Auszug aus „Der Faktor Mensch“
Bild: © fotolia/Studio CI Art

 Health Care Management
Health Care Management