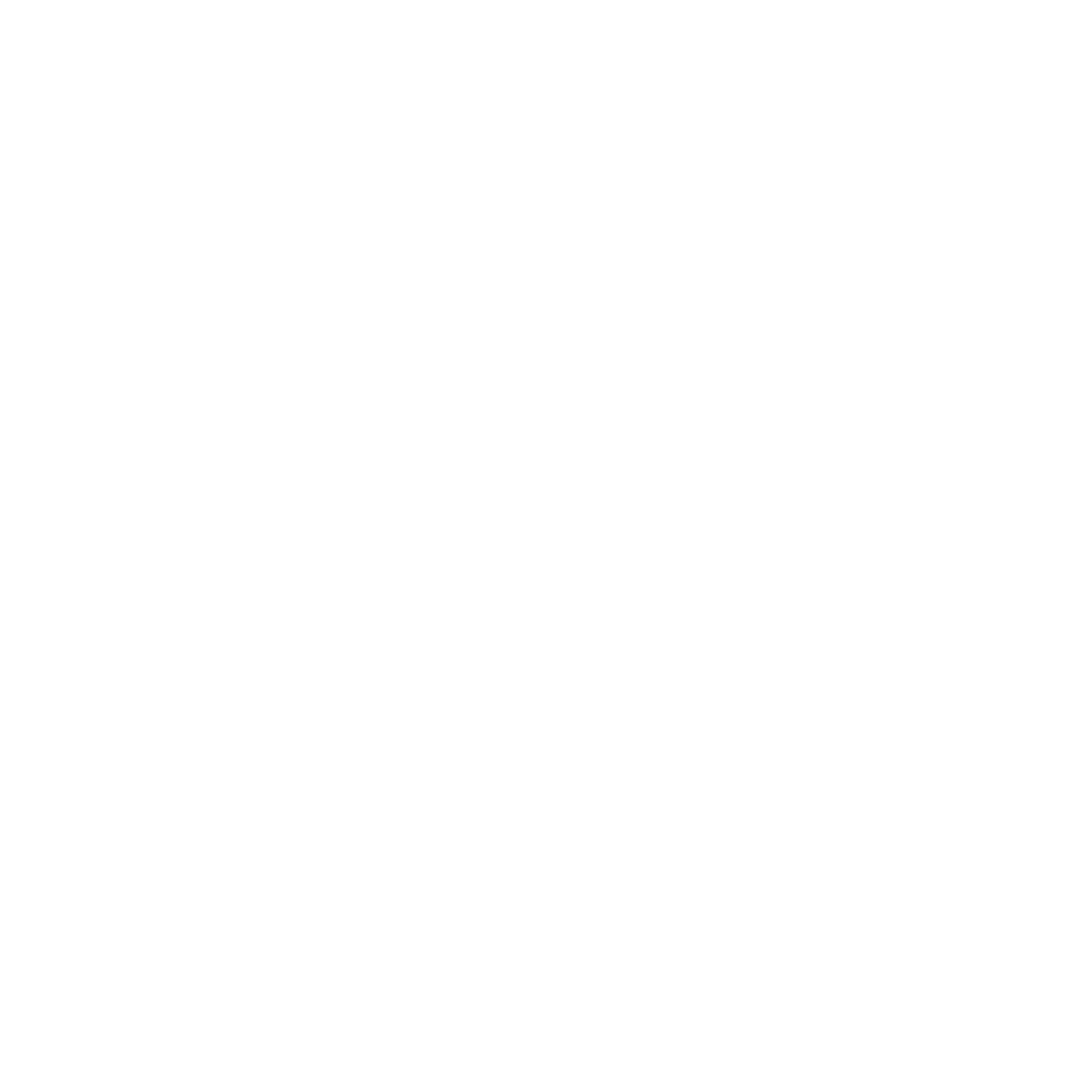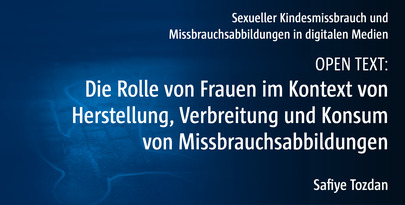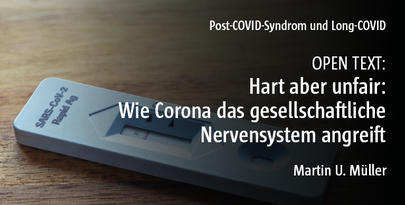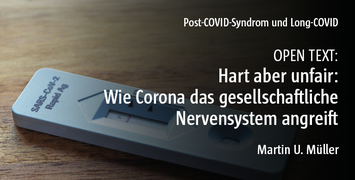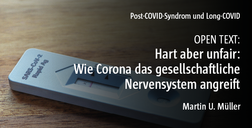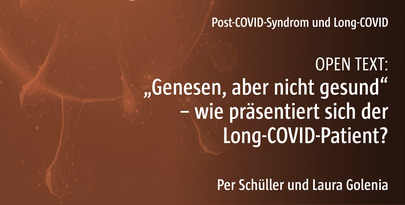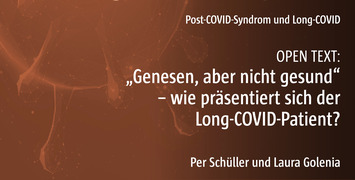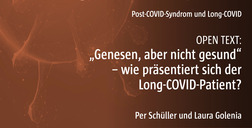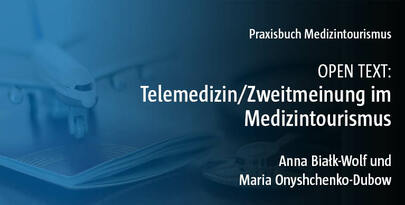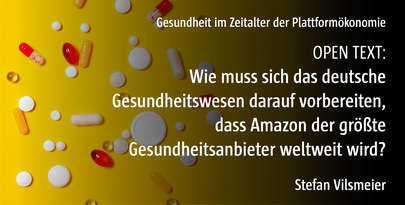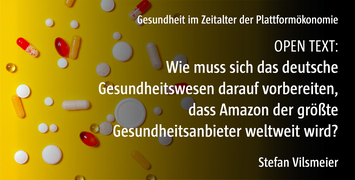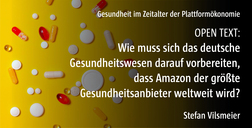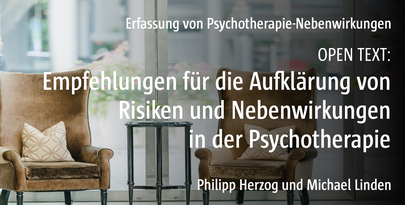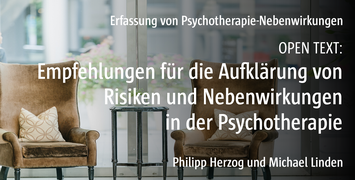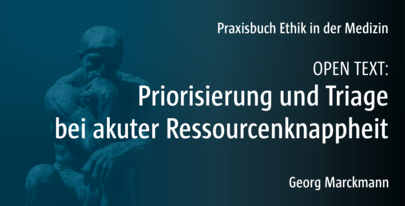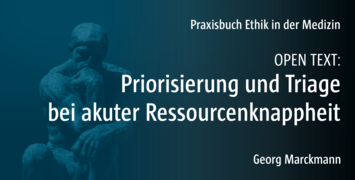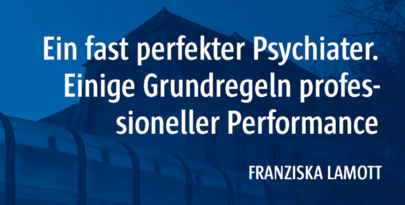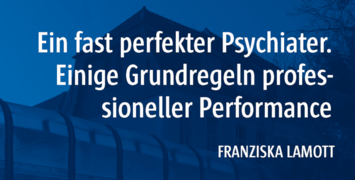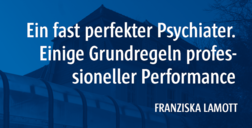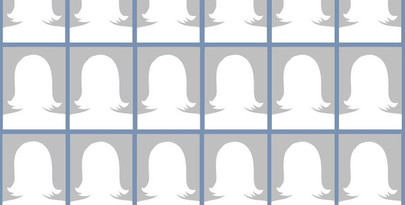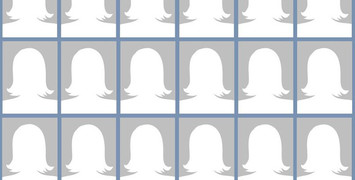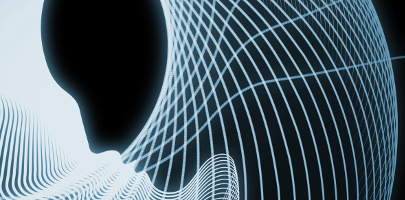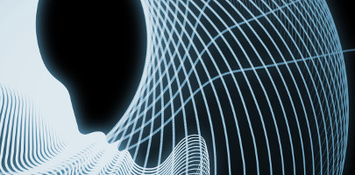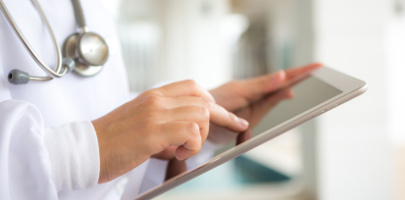Machen Städte uns krank?
MAZDA ADLI
Sind Städte eine Belastung für die psychische Gesundheit ihrer Bewohner? Die Antwort ist: ja, in gewisser Weise sind sie es. Obwohl die Stadt für die meisten von uns Freiheit und persönliche Entfaltung bedeutet, kann sie uns dennoch unter bestimmten Bedingungen krank machen.
Es leuchtet prompt ein, dass Stadt und Stress etwas miteinander zu tun haben. Und es ist gleichzeitig gut gezeigt, dass Stress einen erheblichen Einfluss auf unser Leben und unsere Gesundheit hat. Andererseits lebt die Stadtbevölkerung unter durchschnittlich besseren Bedingungen: größerer Wohlstand, bessere Lebensstandards, mehr Bildung und eine bessere Gesundheitsinfrastruktur, mehr Zugang zu sozialer und kultureller Diversität – Faktoren, die man unterdem Stichwort „Urban Advantage“ zusammenfassen kann. Fangen Städte also den Stress, den sie verursachen, durch die besseren Lebensbedingungen nicht wiederauf?
Was ist „Stadtstress“?
Dieallgemeine psychologische Definition von Stress lautet: Stress ist eine unspezifische psychische oder körperliche Reaktion auf eine bevorstehende Anforderung.
Stressoren können vielgestaltig sein. Zu den häufigsten Formen von Stress gehört physikalischer, sozialer oder emotionaler Stress. Das Ausmaß der Stressreaktion hängt vor allem von der Ungewissheit ab, ob eine Anforderung aus eigener Kraft bewältigt werden kann. Je größer die Diskrepanz zwischen der Anforderung und der subjektiv empfundenen Fähigkeit, die Anforderung zu bewältigen, desto stärker der Stress. In der Stressforschung unterscheiden wir dabei zwischen akutem und chronischem Stress. Akuter Stress ist im Allgemeinen zeitlich begrenzt und dadurch besser einschätzbar. Gesundheitsrelevant ist vor allem chronischer Stress, besonders wenn er als subjektiv unkontrollierbar und unvorhersehbar eingeschätzt wird.Chronischer Stress kann eine Reihe von stressassoziierten Erkrankungen, wie z.B. Depressionen, zur Folge haben. Die Weltgesundheitsorganisation hat Stress zu einer der größten Gesundheitsherausforderungen des 21. Jahrhunderts erklärt.
Die Stressreaktion sowie die Fähigkeit, Stress zukompensieren und auszuhalten, wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Zu den wichtigsten Stressmodulatoren gehören die Persönlichkeitsstruktur, Varianten in Genen, die mit der Stressantwort des Organismus im Verhältnis stehen, die Responsivität unserer Stresshormone (wie z.B. Cortisol), aber auch die emotionalen Umstände, unter denen ein Mensch aufgewachsen ist. Gerade diese hinterlassen Spuren in der Konfiguration unserer Gene und beeinflussen die spätere Anfälligkeit für Stressfolgeerkrankungen. Und, wie oben erläutert, scheint es auch einen Einfluss zu haben, ob jemand in der Stadt oder auf dem Land großgeworden ist.
Städte können Stress verursachen. Doch worin genau besteht der spezifische Stress der Stadt?
Die Gleichzeitigkeit von sozialer Dichte und sozialer Isolation – Phänomene, die in Städten häufiger vorkommen als auf dem Land – führt zu sozialem Stress.
Wir verfolgen eine Sozialstresshypothese von Stadtstress (Adli et al. 2017). Sozialer Stress gehört zu den auch experimentalpsychologisch stärksten Stressoren bei Mensch und Tier (Martin etal. 2015; Shively et al. 2009). Gut bekannte soziale Stressoren sind soziale Dichte sowie soziale Isolation. Studien belegen, dass hohe soziale Dichte und Enge zu enormem Stresserleben, Verhaltensänderungen und Krankheiten führen können. Das kann an fast allen Spezies beobachtet werden, von Insekten, Primaten bishin zum Menschen (Alvarado et al. 2015; Lin et al. 2015; Proudfoot u. Habing2015). Andere Studien zeigen wiederum, dass soziale Isolation einen großen Effekt hat und Gesundheit stärker beeinträchtigt als Rauchen, Alkohol oder Fettleibigkeit (Holt-Lun-stadt et al. 2015).
Wenn soziale Dichte und soziale Isolation zusammentreffen, entsteht eine „toxische Mischung“, die im Zusammenspiel mit weiteren Risikofaktoren, wie zum Beispiel einem genetisch erhöhten Erkrankungsrisiko, nach dem Stress-Diathese-Modell einer Erkrankung Vorschub leistet. Die Gleichzeitigkeit von Dichtestress und Isolationsstress führt zum Beispiel in der Angst vor Statusverlust oder körperlicher Bedrohung bei gleichzeitiger Einsamkeit. Wer der Dichte der Großstadt ausgesetzt ist und sie als nicht oder nur schwer kontrollierbar empfindet und gleichzeitig die Erfahrung von sozialem Ausschluss und Isoliertheit macht, dem setzt Stadtleben zu. Große soziale Unterschiede, Kriminalitätsrate und schlechte Wohnbedingungen potenzieren diesen Effekt vermutlich noch.
Eine Untersuchung aus dem Zentralinstitut fürSeelische Gesundheit in Mannheim hat durch funktionelle Kernspintomographie die Interaktion aus sozialem Stress und Urbanität in eindrucksvoller Weise gezeigt (Lederbogen et al. 2011). Für die Studie wurden Versuchspersonen ausgewählt, von denen ein Teil auf dem Land lebte, ein weiterer Teil in einer Kleinstadt und ein dritter Teil in einer Großstadt. Die Probanden mussten sich im Scanner einem sozialen Stresstest unterziehen. Dabei mussten kaum lösbare Kopfrechenaufgaben unter Zeitdruck gelöst werden. Gleichzeitig gab es kontinuierlich negatives Feedback und abwertende Kommentare durch die Versuchsleiter, über die die Probanden natürlich vollständig aufgeklärt wurden. Währenddessen wurde die Hirnaktivität der Versuchspersonen gemessen. Untersucht wurden dabei Hirnregionen, die in der Stressverarbeitung eine wichtige Rolle spielen.
Von den aktivierten Hirnarealen fielen zwei besonders auf, die eng mit der Emotionsprozessierung unter Stress im Zusammenhang stehen: die Aktivität der Amygdala, einer Region, die vor allem negative Emotionen und Bedrohung verarbeitet, war umso größer, je größer die Stadt war, in der die Versuchsperson gegenwärtig lebte. Die Aktivität in einer weiteren Region, dem zingulären Kortex, zeigte auch einen Zusammenhang: Sie war davon abhängig, wie lange jemand in einer Großstadt aufgewachsen war. Die Stärke der Verbindung zwischenden beiden Arealen war ebenfalls davon abhängig, wo die Versuchsperson aufgewachsen ist.
Diese Befunde sind von großer Bedeutung vor dem Hintergrund der gerade in den letzten Jahren zunehmenden Hinweise auf den unmittelbaren Einfluss von Stress in der Kindheit auf das Depressionsrisiko im späteren Erwachsenenalter. Problematisch scheint sozialer Stadtstress – dessen einzelne Bestandteile allerdings noch nicht gut genug verstanden sind – vor allem dann, wenn er auf andere Risikofaktoren trifft, wie zum Beispiel hohes Alter oder eine Migrationsgeschichte – beides unabhängige Risikofaktoren für soziale Isolation oder Ausschlusserfahrung, die den Zugang zum „Urban Advantage“ erschweren. Eine Studie aus der Charité lieferte jüngst einen weiteren interessanten Beleg für die Sozialstresshypothese: Sie fand bei türkischstämmiger Bevölkerung in zwei innerstädtischen Bezirken Berlins (Moabit, Wedding) heraus, dass erlebte Armut in der Nachbarschaft viel mehr psychische Beschwerden erklärt als die eigene wirtschaftliche Situation (Rapp et al. 2015). Schwierige wirtschaftlicheVerhältnisse im umgebenden sozialen Umfeld werden zur wenig beeinflussbaren Bedrohung für den eigenen Status.
Konsequenzen der Stressforschung im städtischen Kontext
Wie sind die Befunde zum Thema „Stadt- stress“ einzuordnen? Welche Konsequenzen ergeben sich aus ihnen?
Die wichtigste Botschaft ist zunächst: Großstädte und Megacities verursachen nicht per se psychische Probleme. Aber: Stadtleben verändert unsere stressabhängige Emotionsverarbeitung. Das kann problematisch werden, wenn weitere Risikofaktoren genetischer, sozialer (s. oben) oder demographischer Art hinzukommen – und vor allem, wenn jemand am Stadtleben nicht partizipieren kann und der Zugang zum „Urban Advantage“ erschwert ist.
Wenn einerseits Urbanisierung eine rasant fortschreitende Entwicklung ist und andererseits bestimmte stressabhängige psychische Erkrankungen bei Stadtbewohnern häufiger vorkommen, dann ist es entscheidend, den Zusammenhang zwischen Stadtleben und psychischer Gesundheit besser zu verstehen. Wie wirkt sich die gebaute und die soziale Umwelt auf die Psyche und damit auf das Gehirn aus? Wenn wir diesen Zusammenhang besser kennen, lassen sich gesundheitsbezogene, stadtplanerische und soziale Maßnahmen entwickeln, um die psychische Gesundheit von Stadtbewohnern zu fördern.
Was hilft gegen Stress in der Stadt?
Die Verminderung der sozialen Dichte und die Förderung von Gelegenheiten, bei denen Menschen in Kontakt kommen.
Die Minimierung sozialer Isolation in Hochrisikogruppen.
Informationen über Stress und den Umgang mit ihm zur Verfügung stellen.
Neurourbanistik
Hieraus erwachsen Forschungsfragen, die ein interdisziplinäres Vorgehen zwischen den neurowissenschaftlichen und den Planungsfächern (Architektur, Stadtplanung, Sozialwissenschaften) erfordern. Wir haben hierzu den Begriff „Neurourbanistik“ vorgeschlagen, der diese neue und notwendige Disziplin beschreiben soll (Adliet al. 2016). Auf diese Weise soll der Zusammenhang zwischen sozialem Gefüge, stadträumlicher Beschaffenheit und psychischer Gesundheit erforscht werden. Die Neurourbanistik zielt auf die Entwicklung von urbanen Public Mental Health Strategien, die die Resilienz von Stadtbewohnern stärkt.
Literatur
Adli M, Berger M, Brakemeier E-L, Engel L,Fingerhut J, Hehl R, Heinz A, Mayer HJ, Matussek T, Mehran N, Tolaas S, WalterH, Weiland U, Stollmann J (2016) Neurourbanistik: ein me-thodischerSchulterschluss zwischen Stadtplanung und Neurowissenschaften. Die Psychiatrie13(2): 70–78
Adli M, BergerM, Brakemeier E-L, Engel L, Fingerhut J, Go-mez-Carrillo A, Hehl R, Mayer HJ,Mehran N, Tolaas S, Wal-ter H, Weiland U, Stollmann J (2017) Neurourbanism:to-wards a new discipline. Lancet Psychiatry 4(3): 183–185
Alvarado SG,Lenkov K, Williams B, Fernald RD (2015) Social Crowding during DevelopmentCauses Changes in GnRH1 DNA Methylation. PLoS One 10(10):e0142043
Holt-Lunstad J,Smith TB, Baker M, Harris T, Stephenson D (2015) Loneliness and socialisolation as risk factors for mortality: a meta-analytic review. PerspectPsychol Sci 10(2): 227–37
Lederbogen F,Kirsch P, Haddad L, Streit F, Tost H, Schuch P, Wüst S, Pruessner JC, RietschelM, Deuschle M, Meyer-Lin-denberg A (2011) City living and urban upbringingaffect neural social stress processing in humans. Nature474(7352): 498–501
Lin EJ, Sun M,Choi EY, Magee D, Stets CW, During MJ (2015) So-cial overcrowding as a chronicstress model that increases adiposity in mice. Psychoneuroendocrinology 51:318–30
Martin LJ,Hathaway G, Isbester K, Mirali S, Acland EL, Nie-derstrasser N, Slepian PM,Trost Z, Bartz JA, Sapolsky RM, Sternberg WF, Levitin DJ, Mogil JS (2015)Reducing social stress elicits emotional contagion of pain in mouse and humanstrangers. Curr Biol 25(3): 326–32
Proudfoot K,Habing G (2015) Social stress as a cause of di-seases in farm animals: Currentknowledge and future directions. Vet J 206(1): 15–21
Rapp MA, KlugeU, Penka S, Vardar A, Aichberger MC, Mundt AP, Schouler-Ocak M, Mösko M, ButlerJ, Meyer-Linden-berg A, Heinz A (2015) When local poverty is more im-portantthan your income: Mental health in minorities in inner cities. WorldPsychiatry 14(2): 249–50
Shively CA,Register TC, Clarkson TB (2009) Social stress, vi-sceral obesity, and coronaryartery atherosclerosis in fe-male primates. Obesity (SilverSpring) 17(8): 1513–20
Auszug aus dem Beitrag "Machen Städte krank? Plädoyer für eine "Neurourbanistik" in dem aktuellen Titel "Health Care der Zukunft 6"
Bild: © fotolia/frankpeters

 Health Care Management
Health Care Management