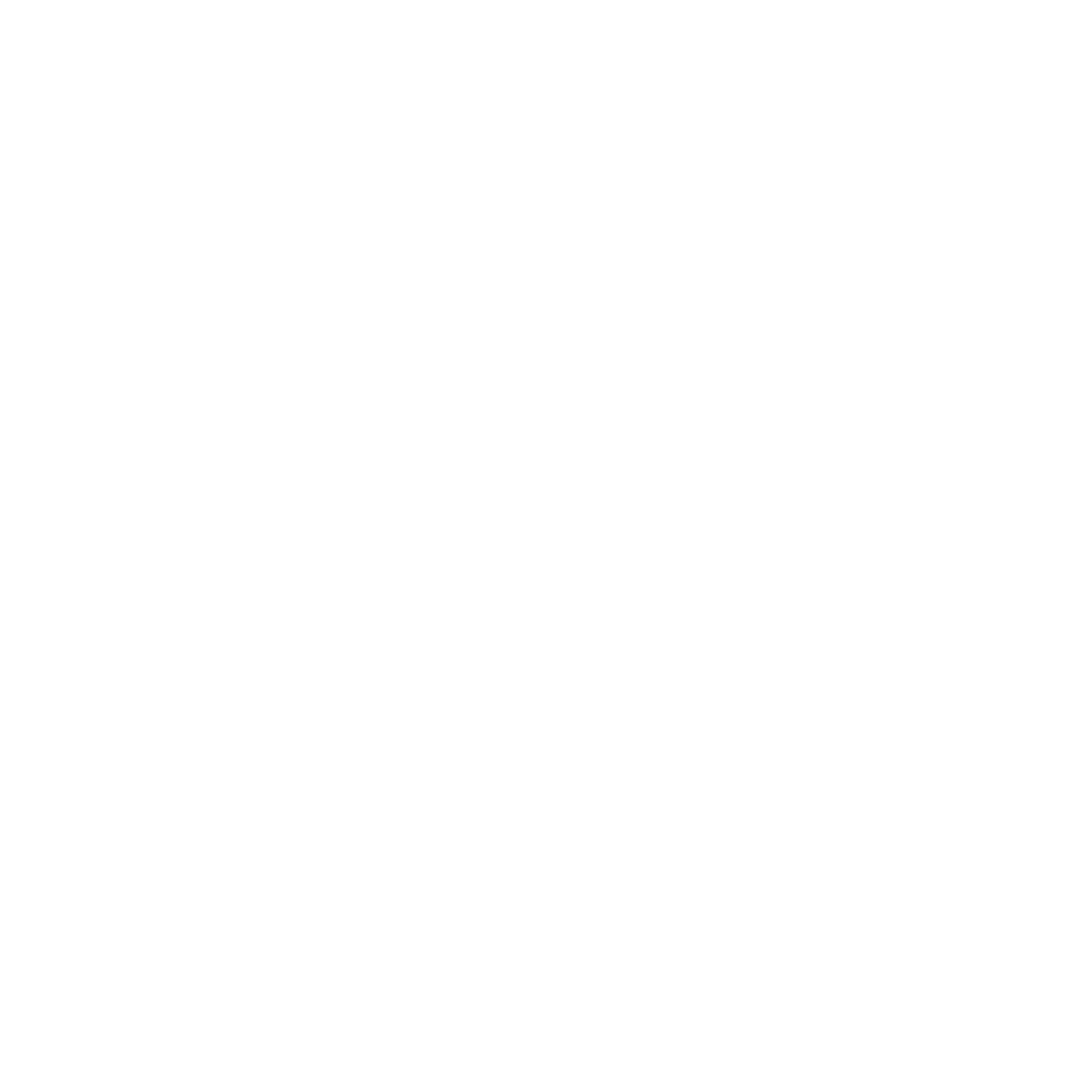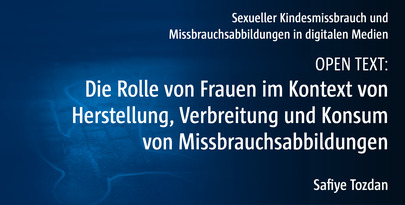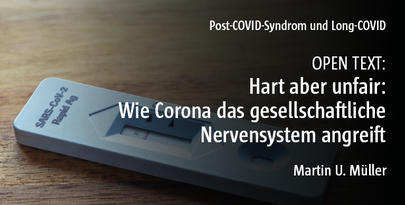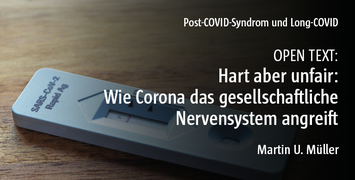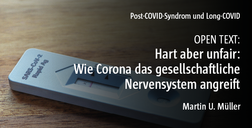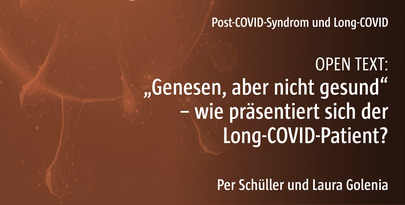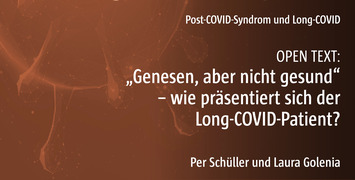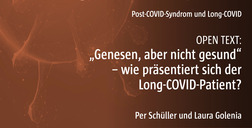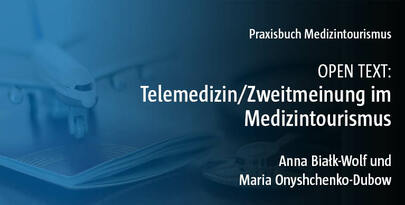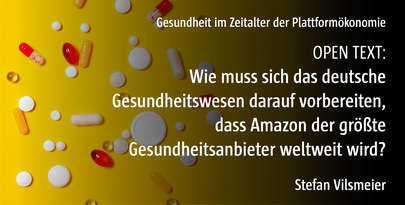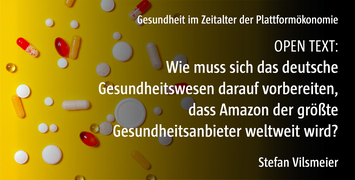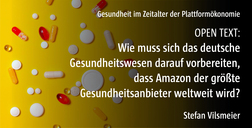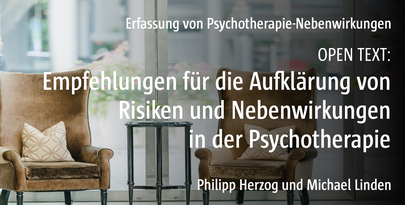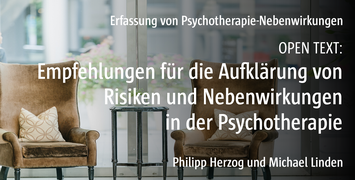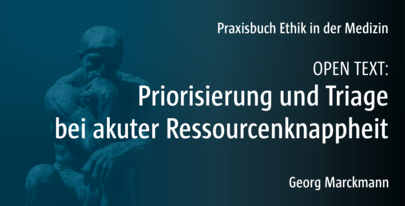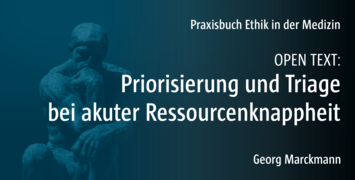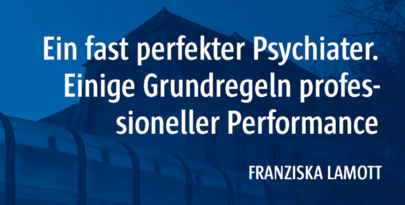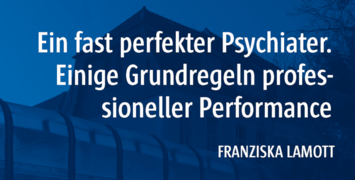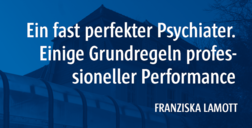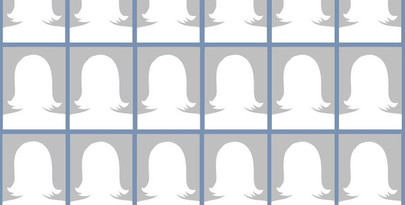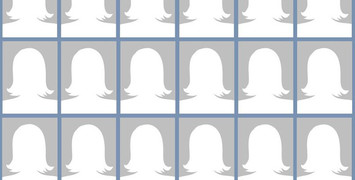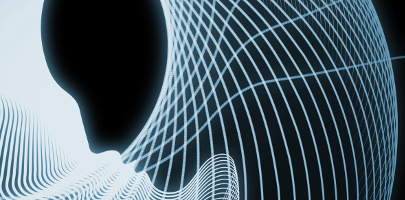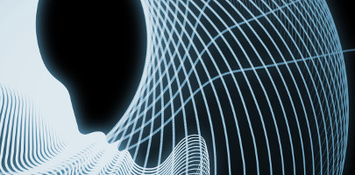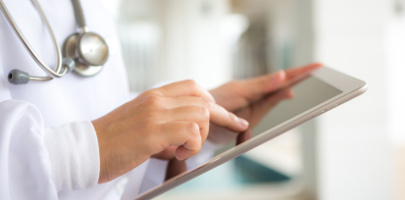Design Thinking
Wie du mit Design Thinking die Zukunft der Medizin gestalten kannst
Sven Jungmann
1. Innovationen entstehen mit System und Kreativität
Hast du dich jemals gefragt, wie die Erfindung des Laiendefibrillators ablief? Oder wie viele Diskussionen in die Entwicklung der ersten digitalen Tastatur des iPhones geflossen sind?
Start-ups und Designagenturen setzen daher auf etablierte Kreativtechniken, um kunden- bzw. nutzerzentriert zu sein, wovon Design Thinking möglicherweise die berühmteste ist. Es umfasst fünf Phasen: Einfühlen, Definieren, Ideieren, Prototypisieren und Testen. Stell dir vor, du solltest die Erfahrung von Patient:innen verbessern, die mit dem Patiententransport durch die Klinik zu bestimmten Untersuchungen gefahren werden.
Zuerst müsstest du dich in deren Situation einfühlen. Dafür gibt es viele Wege. Du könntest dich selbst als Patient:in einchecken und es mit den eigenen Sinnen erfahren. Oder jemanden bitten, eine Kamera auf der Stirn zu tragen (du würdest bei der Aufzeichnung von einer bettlägerigen Patientin wahrscheinlich zu 70%Krankenhausdecken anschauen) oder dir von deren Erfahrungen berichten lassen. Vielleicht würdest du dich auch vor die Untersuchungsräume stellen, wo viele Transporte stattfinden und einfach die Situation beobachten, die Klänge und Gerüche wahrnehmen etc.
Wenn du die Situation wirklich klar verstanden hast, kannst du anfangen, die wichtigsten Probleme zu definieren– zum Beispiel, dass es ziemlich langweilig ist und man sich sehr fremdgesteuert fühlt, wenn man nicht sieht, wohin man gebracht wird, nicht weiß, wie lange man warten muss und vielleicht auch nicht ganz versteht, welche Untersuchung einen genau erwartet.
Und dann kannst du anfangen, dir über Lösungen Gedanken zu machen. Am Anfang geht es erst mal darum, möglichst viele Ideen zu sammeln („ideieren“), denn es ist in diesem Stadium unglaublich schwierig eine brillante von einer dämlichen Idee zu unterscheiden.
Und dann geht es auch schon ans Prototypisieren und Testen, um direkt von den Anwender:innen zu lernen. Einer der früheren Prototypen der iPhone-Tastaturen war übrigens eine Morsekode-Tastatur. Dann gab es eine Tastatur, bei der mehrere Buchstaben auf einer virtuellen Taste lagen. Erst nach vielen Iterationen landeten sie bei einer Tastatur, die der heutigen noch sehr ähnelt.
Genau wie bei dem Tastatur-Beispiel gibt es üblicherweise eine Vielzahl an Ansätzen, die in einem Design Thinking-Prozess zutage kommen und getestet werden. Wie du dir denken kannst, laufen diese Phasen nicht zwangsweise linear eine nach der anderen ab, sondern iterativ. Denn in jedem Schritt geht es darum, sich selbst und seine Ideen ständig zu hinterfragen. Und zu jeder Zeit geht es im Kern darum, die Nutzer:innen wirklich tiefgreifend zu verstehen und Probleme stets neu zu definieren. Das Ergebnis sind Lösungen, die sich so natürlich anfühlen sollen, dass man gar nicht darüber nachdenkt, wieso deren Ausgestaltung eigentlich so ist wie sie ist.
Es werden also konstant sowohl Problem als auch Lösung hinterfragt, bis man einen perfekten Match zwischen beiden hat. Allerdings ist man nie fertig, denn immer wieder werden bestehende Ideen und Erkenntnisse hinterfragt, um so stetig Verbesserungen zu entwickeln.
Bei diesem Kreativprozess kann man schnell den Überblick verlieren. Deswegen gibt es im Design Thinking drei Säulen, die als Filter wirken:
- Technische Realisierbarkeit: Welche Ressourcen, welches Budget und welcher rechtliche Rahmen stehen dir für deine Innovation zur Verfügung?
- Wirtschaftlichkeit:Was ist aus unternehmerischer Sicht realisierbar?
- Begehren:Was wollen deine Nutzer:innen überhaupt?
Jede einzelne der Entscheidungen in der EntwicklunG einer Innovation sollte diese Säulen, die zahlreiche Fragen beinhalten können, durchlaufen. Der „Sweetspot“ der Innovation befindet sich an der Intersektion zwischen diesen drei Säulen, so die traditionelle Sichtweise. Macht alles Sinn soweit? Seit einiger Zeit versucht man, Design Thinking auch im Gesundheitswesen einzusetzen. Aber ganz so gut klappt es nicht, denn im Gesundheitskontext gibt es Besonderheiten, die berücksichtigt werden müssen. Diese Besonderheiten ergeben sich vor allem darum, dass viele Patient:innen nicht wissen, was sie aus medizinischer Sicht brauchen und dass die evidenzbasierte Medizin nochmals ganz andere Anforderungen an Innovationen hat als das in anderen Bereichen der Fall ist. Darum geht es in diesem Kapitel.
2. Damit Design Thinking im Gesundheitswesen funktioniert, brauchst du viele Perspektiven
Wenn du als Mediziner:in irgendwann in deiner Laufbahn mal in ein Digitales Medizin Start-up involviert bist oder vielleicht auch einfach nur Prozesse in deiner Praxis optimieren möchtest, solltest du beider Umsetzung auf Design Thinking zurückgreifen. Doch einen kleinen Haken gibt es dabei noch. Denn wenn du Design Thinking so, wie ich es dir bislan gvorgestellt habe, auf das Gesundheitswesen überträgst, wirst du als Arzt:Ärztin früher oder später an deine Grenzen stoßen. Bei der Arbeit am Menschen kann eine neue Software oder App zwar absolut wirtschaftlich, realisierbar und außerdem wünschenswert sein – aber sie kann trotzdem enormen Schaden anrichten. Wie bei Medikamenten, Operationen oder Therapien muss auch hier belegt sein, dass sich Ergebnisse verbessern lassen und die Patientensicherheit gewährleistet ist.
Design Thinking fokussiert sich oft auf die subjektiven Bedürfnisse der Nutzer:innen. Doch im Gesundheitswesen gibt es viele Bedarfe, die Patient:innen nicht klar sind, weil sie beispielsweise keinen Leidensdruck verspüren (denke an die subklinische Hypertonie oder einen Diabetes mellitus Typ II im frühen Stadium). Während sich Design Thinking typischerweise auf explizites „Begehren“ fokussiert (s. o.), geht es in der Medizin oft darum die den Patient:innen unbekannten Bedürfnisse des Körpers zu vermitteln. Beispiel: In anderen Industrien ist es vergleichsweise leicht, die Bedürfnisse der Nutzer:innen zu identifizieren und eine geeignete Lösung zu finden: Bei einer Bestell-App für Essen wissen die Nutzer:innen, dass sie Hunger haben, sie wissen auch, wie sie ihn stillen können – die App moderiert lediglich die Interaktion mit der Pizzeria.
Im Gesundheitswesen ist das oft schwieriger. Bluthochdruckpatient:innen wissen oft nicht, dass ihr Blutdruck zu hoch ist, sie spüren auch keine Schmerzen und kein Bedürfnis, etwas dagegen zu tun, bis ihr:e Arzt:Ärztin sie dazu aufklärt. Und dann haben sie üblicherweise keine Präferenzen zur Therapie. Hierzu eine App zu bauen ist deutlich schwieriger, da erst mal ein subjektiv gespürter Bedarf vorhanden sein muss.
Dazu kommt erschwerend: Pizza kennt jede:r. Fast jede:r Erwachsene in unseren Breitengraden hat schon hunderte verschiedene Pizzen probiert und daher auch eine Orientierung, um Qualität und Menge schnell beurteilen zu können. Auch das ist bei Gesundheitslösungen oft anders: Hoffentlich sind Gesundheitsprobleme und Interventionen meistens einmalige Lebenserfahrungen – und so fehlen die Referenzwerte. Das bedeutet: in der Medizin sind sowohl Probleme als auch Lösungen sehr erklärungsbedürftig.
Klassischerweise versucht man im Design Thinking häufig zu lernen, indem man die Zielgruppe beobachtet, befragt, von ihr lernt. Doch wenn diese sich selbst nicht ihrer Probleme und Bedarfe bewusst ist oder zu wenig von dem Problem verstehen, um eigene Lösungen zu entwickeln, funktioniert dieser direkte Ansatz oft nicht.
Man muss hier häufig etwas „über Bande spielen“ und auch Ärzt:innen und Pflegekräfte interviewen und beobachten.
Bewährte Fragen an die Kolleg:innen, um wichtige Bedarfe und Probleme bei Patient:innen aufzudecken, sind beispielsweise:
- Welche Sachverhalte müssen Sie Ihren Patient:innen immer wieder erklären, weil diese ihnen nicht bewusst sind?
- Was sind die häufigsten Missverständnisse, mit denen Patient:innen zu Ihnen kommen?
- Welche Informationen überraschen Ihre Patient:innen üblicherweise?
Kurzum: je mehr Perspektiven, desto mehr Denkanstöße und Ideen kommen zusammen.
Und es gibt noch einen Grund, die anderen „Teilnehmer:innen“ im Gesundheitswesen in den Innovationsprozess einzubeziehen. Die Maxime bei Innovationen ist, dass man „kundenzentriert“ sein muss. Doch wer sind denn eigentlich im Gesundheitswesen diese „Kund:innen“?
Die übliche (und naive) Antwort ist, kundenzentriert in patientenzentriert zu übersetzen. Aber das macht die Welt der Medizin zu einfach, denn selten finden Gesundheitsinterventionen an Patient:innen im Vakuum statt. Es gibt fast immer auch Angehörige, Ärzt:innen, Pflegekräfte und Therapeut:innen, die involviert sind.
Stell dir vor jemand will das Problem lösen, dass Krebspatient:innen vor der nächsten Chemotherapie-Gabe eine Blutuntersuchung zu Hause statt in der Klinik durchzuführen, damit die Betroffenen nicht mit schlechtem Immunsystem im Nadir extra in die Klinik fahren müssen, nur um dann wieder nach Hause geschickt werden, weil die Leukozyten zu schlecht sind. Das ist sicher auch im Interesse der Angehörigen, die sich häufig einen Tag frei nehmen, um Erkrankte zur Chemo zu begleiten. Aber wie soll die Entnahme zu Hause stattfinden? Wahrscheinlich müssten Pflegekräfte oder ärztliches Personalnach Hause kommen. Was wäre, wenn es eine Kapillarblutbestimmung ähnlich der Blutzucker-Messung gäbe, die Laien zuverlässig selbst an sich durchführen könnten? Wahrscheinlich wäre das auf den ersten Blick wünschenswert. Doch würden die Onkolog:innen damit zufrieden sein? Vielleicht würden sie trotzdem auch eine Televisite haben wollen, um sicher zu gehen, dass es den Patient:innen gut geht, selbst wenn diese noch nicht bereit für die nächste Chemo sind?
Das sind alles nur Beispiele, die Quintessenz ist jedoch, dass man beim Design Thinking im Gesundheitswesen ganz schön viele Perspektiven berücksichtigen muss und dabei jedoch nicht in der Komplexität ertrinken darf (das wäre dann wohl eher „Design Sinking“). Damit das nicht passiert, muss du genau das machen, was du auch in der Notaufnahme tust: Triagieren – „Treat first what kills first“
Wenn immer du etwas Neues entwickelst, das es bisher noch nicht gab, basierst du naturgemäß alle deine Entscheidungen auf Hypothesen. Und unter all deinen Hypothesen sind manche gefährlicher für das Überleben deiner Idee als andere. Als der Zappos-Gründer startete, war nicht klar, ob Leute wirklich Lust haben, Schuhe online zu kaufen oder ob sie nicht lieber verschiedene direkt im Laden ausprobieren. Die Hypothese, dass Kund:innen einen Online-Shop dem Ladenlokal vorziehen war erst mal nur eine Hypothese von vielen. Doch diese Hypothese war besonders kritisch und musste zuerst validiert werden. Er ging daher so vor, dass er zunächst einen Online-Shop einrichtete ohne ein eigenes Lager zu haben und wenn jemand bestellte, ging er in ein Schuhgeschäft, kaufte die Schuhe und verschickte sie ohne Gewinn an die Kund:innen. Erst als er merkte, dass das funktionierte, begann er sich den nächsten wichtigen Hypothesen zu widmen (was auch immer das dann war).
Erfolgreiche Innovation beruht auf vielen kleinen Experimenten, die immer die riskantesten Annahmen zuerst validieren.
3. Design Thinking im Gesundheitswesen braucht eine vierte Säule: Effektivität
Hier kommt die nächste Besonderheit im Gesundheitswesen. Mit dem Durcharbeiten der drei Säulen und einem attraktiven Nutzungsversprechen ist es bei der Produktentwicklung in der Gesundheitsbranche noch nicht getan. Denn auch, wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung noch so innovativ ist, muss es erstens sicher und zweitens wirksam sein. Im Zeitalter der evidenzbasierten Medizin reicht es nicht mehr, dass ein Produkt neu ist oder ein intuitiv charmantes Nutzenversprechen hat. Es muss auch nachweislich Vorteile für die Patient:innen bringen.
E-Zigaretten sind perfekt realisierbar, begehrt und wirtschaftlich (Säulen eins bis drei), aber können zu erheblichen Gesundheitsschaden führen, auch wenn sie häufig als geeignetes Mittel der Raucherentwöhnung empfohlen werden. Bei Gesundheitsinnovationen muss man stets auch die Sicherheit im Auge haben und überlegen, was schiefgehen kann und entsprechend vorausschauend seine Erfindung designen. Und dann kommen klinische Studien ins Spiel, mit denen du belegen musst, dass du die versprechen deiner Innovation auch halten kannst.
Anders gesagt: Um den Anforderungen der evidenzbasierten Medizin gerecht zu werden, braucht es eine vierte Säule für das Design Thinking in der Medizin: die Effektivität. Innerhalb dieser vierten Säule integrieren wir Sicherheitsaspekte und die Nachweisbarkeit der positiven Wirkung automatisch in den Entwicklungsprozess. Denn nur ein nachweisbarer Mehrwert führt in der Gesundheitsinnovation langfristig zu Erfolg. Kaum jemand in der Medizin nutzt ein Produkt, das zwar cool aussieht und Spaß macht, dessen Wirksamkeit und Sicherheit aber nicht belegt ist.
4. Allen vier Säulen gerecht zu werden, ist aufwändig und Iterationszyklen sind langsamer im Gesundheitswesen – aber es lohnt sich
Die „User Experience“ ist von zentraler Bedeutung, egal ob bei einem Defibrillator, einer App oder der Ausgestaltung eines Notaufnahmezimmers. Sie müssen möglichst intuitiv zu benutzen sein, soweit es geht positive Emotionen auslösen und angenehm überraschen. Eine gute UserExperience erreicht man über die schnelle und kontinuierliche Entwicklung und Testung neuer Hypothesen. Die Buchungsplattform Booking.com lässt circa 25tausend Mikro-Experimente pro Jahr auf ihrer Webseite durchführen, um stets das Nutzerlebnis zu verbessern.
In der Medizin sind allerdings derart viele kleine Experimente üblicherweise gar nicht möglich, da man die Sicherheit der Anwender:innen immer in den Vordergrund stellt. Das bedeutet, es muss vor jeder Änderung genau recherchiert und detailliert erarbeitet werden welche Risiken daraus entstehen können. Zum Beispiel, selbst wenn man in einer App einfach nur die Farben ändert, könnte dies für Personen mit Rot-Grün-Schwäche Probleme in der Bedienung erzeugen. Daher muss man immer bei Änderungen zuerst gründlich über Probleme nachdenken, bevor sie am Markt getestet werden können. Die Iterationszyklen sind somit langsamer. Unter anderem deswegen sehen viele „Werkzeuge“ im Krankenhaus deutlich altbackener aus als die vielen anderen Apps, die du so in deinem außerklinischen Alltag verwendest.
Oft gelingt es klassischen Medizinproduktentwickler:innen nicht, wirklich empathische und entzückende Produkte zu entwickeln. Sie sind nachvollziehbarerweise besessen vom Sicherheitsgedanken. Ein Klassiker sind Pop-up-Fenster, die immer wieder gerne eingesetzt werden, um beispielsweise Ärzt:innen vor gefährlichen Medikamenteninteraktionen zu warnen, bevor sie ein Rezept ausstellen. Steht die Sicherheit hier über der Nutzerfreundlichkeit? Eher nicht, denn zu viele Pop-ups können auch nerven und dazu führen, dass man sie einfach blind weg klickt und trotzdem Fehler macht (man nennt das „Alert Fatigue“).
Aber eine gut designte, intuitive Bedienfläche kann dazu führen, dass man sich nicht vertippt oder versehentlich Falschangaben macht. Wer nur aus der Nutzerfreundlichkeit her denkt, kann sicherheitsrelevante Aspekte übersehen, wer nur in Sicherheit denkt, verpasst die Chance, auch auf emotionale Bedürfnisse der Anwender:innen eingehen zu können.
5. Fang einfach mit kleinen Experimenten an und iteriere dich nach vorne
Es ist gar nicht notwendig, dass du bereits zu Beginn ein ausgeklügeltes Konzept für dein Produkt oder eine Prozessinnovation im Kopf hast. Es genügt eine übergeordnete Idee, die später anhand des Design Thinkings mehr und mehr konkretisiert wird. Aber als Ausgangspunkt an solltest du dir über die folgenden drei Fragen Gedanken machen – und deine Antworten immer wieder hinterfragen:
- Wer sind deine Nutzer:innen? Sei dir im Klaren, wer deine Hauptnutzer:innen sind. Und, ebenso wichtig: wer nicht dazu gehört. Man unterliegt schnell der Versuchung, die Zielgruppe einfach über eine Krankheit zu definieren (z.B. „Ich baue eine App für Diabetes-Erkrankte“) – aber kein Mensch definiert sich nur über eine Erkrankung, es ist absolut wichtig, dass man auch andere Charakteristika einbezieht z.B. Job, Lebensstil, Hobbies, Bildung, etc.
- WelchesProblem wird mit deiner Software gelöst? Hilfst du bei der Beschaffung von Insulin (z.B., dass man nicht mehr so oft in die Apotheke muss)? Oder beider Auswertung der Blutzuckerkurven (z.B. um Patient:innen besser beraten zu können)? Oder bei der Insulin-Applikation (z.B., dass man sich nicht mehr piksen muss)? Es gibt viele Probleme zu lösen, aber nicht alle brauchen unbedingt eine Lösung, weil sie beispielsweise nicht groß genug sind oder es bereits einfache Lösungen gibt.
- WelchesErgebnis soll mit deiner Lösung erreicht werden und wie willst du die smessbar machen? „Wir benutzen für unsere innovativen Vitamintabletten nur natürliche Stoffe, deswegen ist die Bioverfügbarkeit besser“, erzählte mir einst ein Unternehmer-Pärchen von ihrem Nahrungsergänzungsmittel-Start-up.„Unser Slogan ist: ‚mit unseren Vitaminen hast Du mehrgeile Tage‘ – mega oder?“. Ich war nicht beeindruckt, denn so intuitiv überzeugend diese beiden Aussagen für Laien auch klingen mögen, die beiden konnten mir weder klinische Belege für die vermutete Bioverfügbarkeit noch für subjektive Outcome Verbesserungen vorlegen. Als Innovator:in im Gesundheitswesen musst du immer klar vor Augen haben, wie du deine Lösungen auf den wissenschaftlichen Prüfstand stellen kann.
Doch bevor es auf den wissenschaftlichen Prüfstand geht, stehen die schnellen Testungen mit den Prototypen auf dem Programm. Das Mantra hier ist „Lernen – Bauen – Messen“ und beginnt immer wieder von vorne, wie im hermeneutischen Zirkel.
6. Design Thinking: Wer die Regeln kennt, darf auch mit ihnen spielen
Design Thinking kann viel Spaß machen. Es soll dir helfen, deine Gedanken zu ordnen und in die richtige Richtung zu lenken –nicht, sie einzuschränken. Wenn du es konsequent anwendest, wirst du immer die vier Säulen im Hinterkopf behalten: Begehren, Wirtschaftlichkeit, Machbarkeit und Effektivität. Und du wirst stets den Hang haben, zuerst die Bedürfnisse deiner Nutzer:innen wirklich zu verstehen und dann schnell deine Hypothesen mit Prototypen zu testen.
Du musst dich jedoch nicht strikt an die Strukturhalten, sondern lediglich daran orientieren. In der Medizin ist man oft in der Kreativität eingeschränkt weil alles reguliert ist und man oft harte Belege braucht, bevor man eine Lösung auf Patient:innen los lässt. Zumindest scheint das auf den ersten Blick so.
In Wahrheit passiert Innovation nicht immer dort, wo man keinerlei Grenzen gesetzt bekommt, sondern dort, wo man innerhalb eines engen Korsetts gezwungen ist, neu über alles nachzudenken, was alle anderen schon als gegeben hinnehmen. Als Mediziner:in hast du den Vorteil, dass du den Status quo sehr gut kennst und die Regeln der evidenzbasierten Medizin verstehst. Je mehr du dich mit Menschen aus völlig anderen Gebieten zusammen tust, desto besser werdet ihr gemeinsam in der Lage sein, die bestehende Realität der medizinischen Versorgung neu zu definieren.
Zurück zum Laiendefibrillator, für den die IDEO-Innovations-Agentur viele verschiedene Prototypen testete. Das Design musste so einfach sein, dass selbst Laien unter Stress in der Lage sind, ein lebensrettendes aber potenziell gefährliches Gerät zum ersten Mal in ihrem Leben und ohne jedwedes Training einzusetzen. Sie kamen schließlich auf die Idee, eine Metapher zu benutzen, die für jeden verständlich ist. Sie gestaltenden Defibrillator wie ein Buch, mit einem Rücken, sodass die Ersthelfer:innen instinktiv wissen, wo sie greifen und beginnen müssen. Dazu wurden die Knöpfe nummeriert und derart nebeneinander platziert, dass automatisch klar wurde, was in welcher Reihenfolge zu tun ist.
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch "Toolbook Ärztin:Arzt" herausgegeben von Jana Luisa Aulenkamp und Dr. med. Thomas Hopfe. Alle Informationen zum Titel erhalten Sie hier.

 Health Care Management
Health Care Management