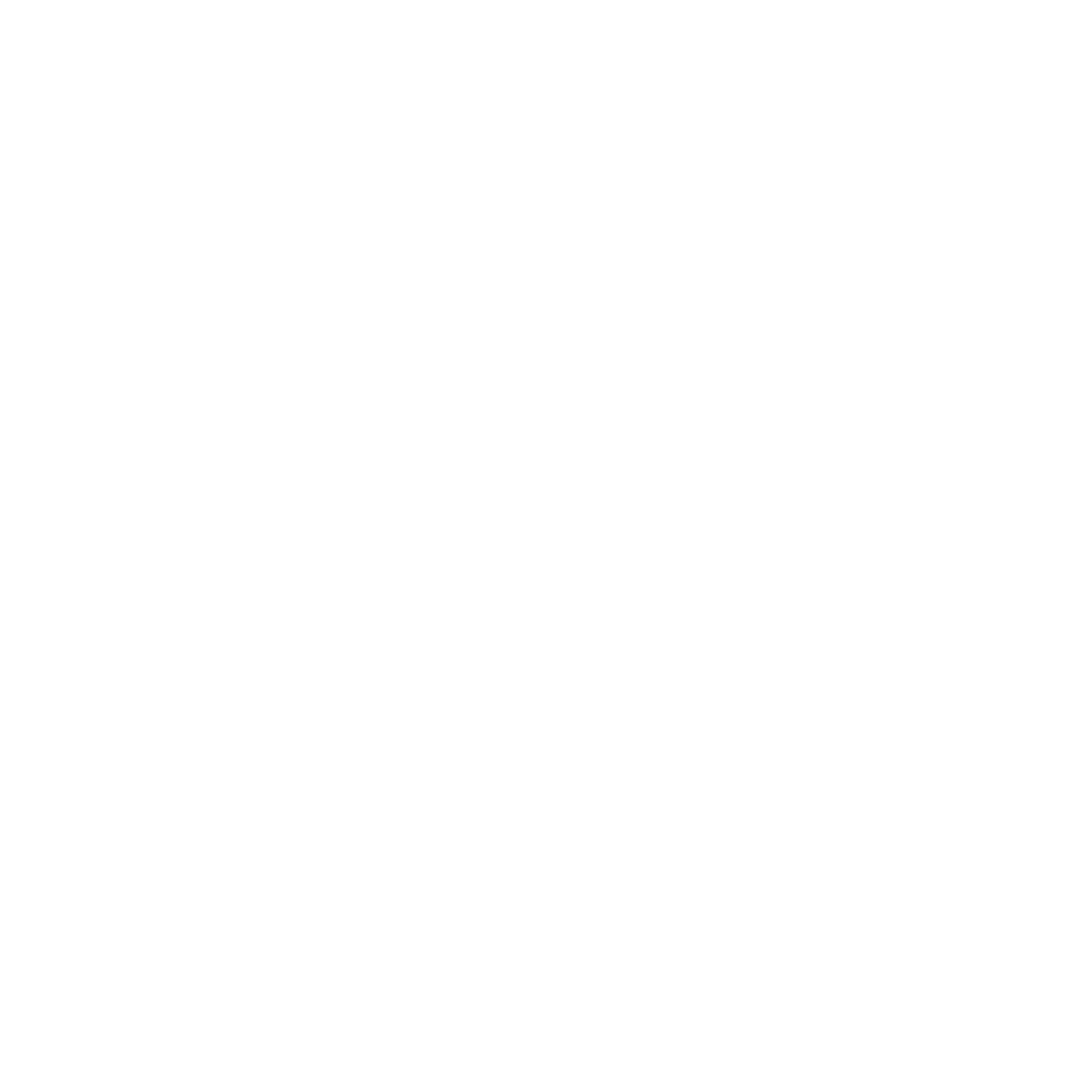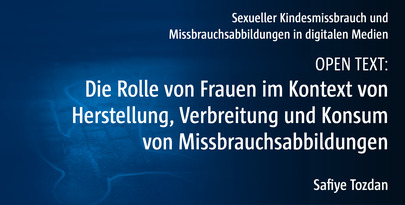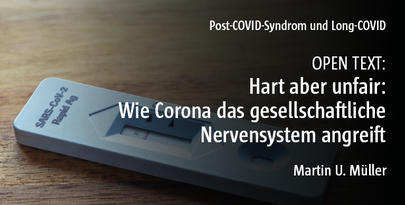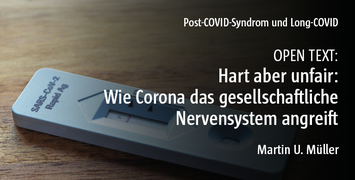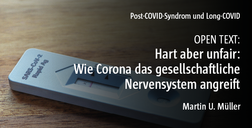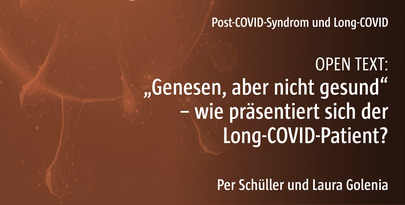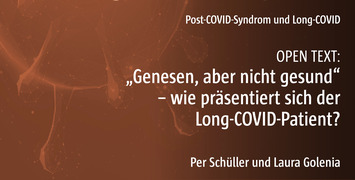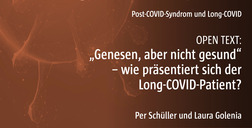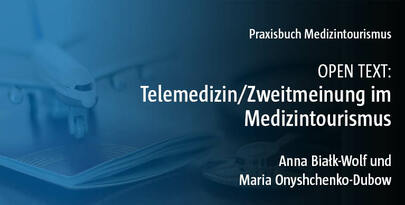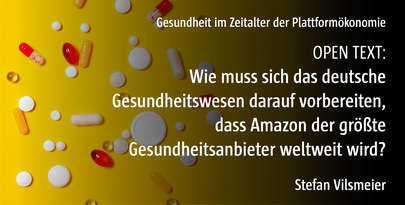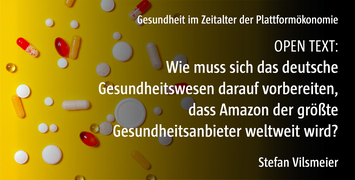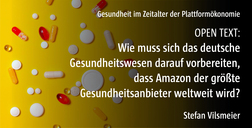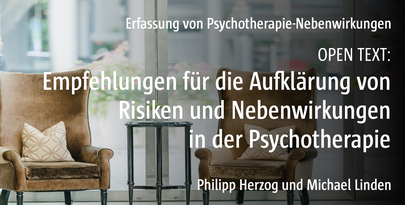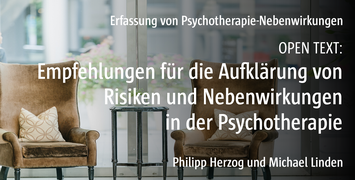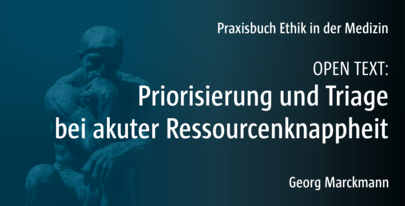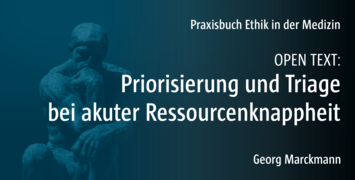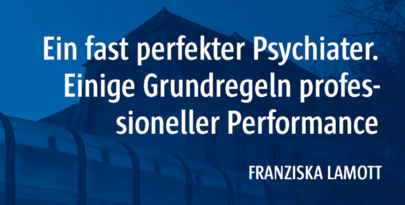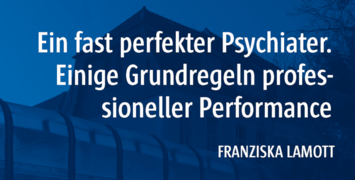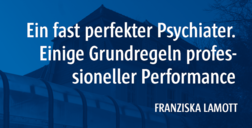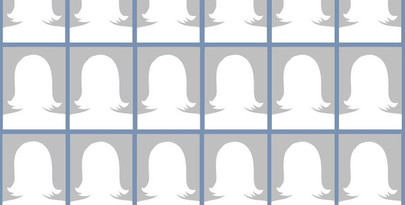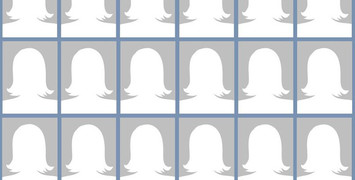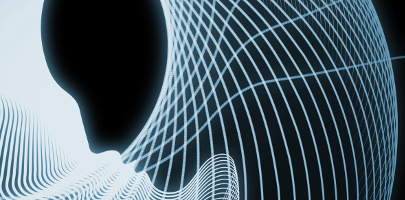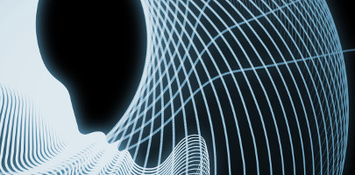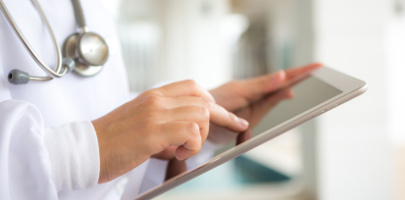Geschlechtersensible Medizin
Geschlechtersensible Medizin
Awa Naghipour und Sabine Oertelt-Prigione
1. Was ist geschlechtersensible Medizin?
Geschlecht wirkt auf biologischer und psychosoziokultureller Ebene, in Interaktion mit der Umwelt und innerhalb von machtpolitischen Verhältnissen auf Gesundheit und Krankheit, auf das Verhalten von Individuen und auf die Qualität der medizinischen Behandlung.
Geschlechtersensible Medizin befasst sich mit der Analyse von Geschlecht als bedeutenden Einflussfaktor in Krankheitsentstehung,-symptomatik, -bewältigung, Diagnostik, Therapie und Prävention.
Geschlechtersensible Medizin ist ein historisches Produkt zweier wesentlicher Handlungsstränge: der Frauengesundheitsbewegung der 70er-Jahre und den Diskursen der sozialwissenschaftlichen Geschlechterforschung. Sie speist sich aus der Erkenntnis, dass eine androzentrische – cis männlich fokussierte (cis bedeutet, dass das zur Geburt zugewiesene Geschlecht der Geschlechtsidentität entspricht) – Sichtweise auf Gesundheits- und Krankheitsprozesse wesentliche Teile der Bevölkerung ausschließt und so konsekutiv zu ihrer mangelhaften gesundheitlichen Versorgung führt. Die Annahme, Frauen und Männer unterscheiden sich lediglich in Bezug auf Reproduktionsorgane – die sogenannte „Bikini Medicine“ – erwies sich sowohl auf naturwissenschaftlicher als auch auf soziopsychokultureller Ebene als unhaltbar. Ein Prozess der Erkenntnisgewinnung und Schließung der Wissenslücke begann und setzt sich bis in die Gegenwart fort.
1.2 Geschlechterdefinitionen – Terminologie und ihre Grenzen
Geschlecht kann mehrdimensional sowohl auf biologischer als auch auf psychosoziokultureller Ebene beleuchtet werden. Die Terminologie, die aktuell in der biomedizinischen Praxis etabliert ist, stammt aus dem angloamerikanischen Raum und differenziert „Sex“ und „Gender“.
Im biomedizinischen Diskurs wird „Sex“ als biologische Variable diskutiert und das englische 3-G-Modell herangezogen, um drei Dimensionen herunterzubrechen:
1. Genes (Genetik)
2. Gonads (Gonaden/Keimdrüsen)
3. Genitalia (Genitalien)
Diese Trias umfasst die Ebenen der Chromosomen, des Hormonhaushalts und der Genitalien. Innerhalb dieser Kategorien können auf jeder Ebene zahlreiche Varianzen auftreten. Dennoch dominiert in der Biomedizin nach wie vor eine binäre Einteilung in „männlich“ und „weiblich“. Durch u.a. soziales Engagement von Intersex-Personen vermehrt sich die Kritik an der Dichotomie von „männlich/weiblich“ und eine Ergänzung um mindestens eine Dimension – Intersex – etabliert sich.
Auch die Kategorie „Intersex“ ist viel diskutiert und der Begriff „Differences of Sex Development“(DSD) wird als Eigenbezeichnung von Intersex-Personen oftmals favorisiert. Allerdings wird DSD in der Medizin auch als „Disorders of Sex Development“ übersetzt und reifiziert die ohnehin bereits etablierte Stigmatisierung nicht binärer Geschlechterkategorien. Abhängig davon, welche Statistiken betrachtet werden, beläuft sich der Anteil der Personen mit DSD nach aktuellem Kenntnisstand auf ca. 0,3–1,7%.
Gender ist ein Konzept, das seine theoretische Substanz aus geistes- und sozialwissenschaftlichen Diskursen nährt und dort seit Jahrzehnten analysiert und konzeptualisiert wird. In der Humanmedizin hat es erst in den 1990er-Jahren graduell Einzug gefunden. Es umschreibt psychosoziokulturelle Ebenen von Geschlecht, die innerhalb gesellschaftlicher Dynamiken wirken. Hier sind mehrere Dimensionen zentral, mitunter Genderidentität, Genderverhältnisse, Gendernormen sowie institutionalisiertes Gender.
Genderidentität ist die Identität, derer ein Individuum angehört und die sie bei sich verortet, sei es weiblich, männlich, non-binär, trans, fluid u.v.m.
Gendernormen beschreiben Erwartungen, die von außen an ein Individuum herangetragen werden, Stereotype, denen Geschlechter zugeordnet werden und gesellschaftliche Rahmen, die als adäquat oder abweichend deklariert werden und so eine Erwartungshaltung implizieren.
Genderverhältnisse umfassen Privilegien, Macht und Partizipationsräume, die je nach Geschlechtsidentität und gendernormiertem Verhalten manchen leichter zugänglich sind als anderen. Ein im kanadischen Raum geprägter Begriff des institutionalisierten Gender beschreibt institutionelle Rollen- und Verhaltenserwartungen, die z.B. mit einer beruflichen odergesellschaftlichen Position einhergehen. Genderverhältnisse tragen in ihrer aktuellen Ausrichtung dazu bei, dass männlich/maskulin deklarierte gegenüber Menschen anderer Geschlechter bevorteilt werden und so Ungerechtigkeiten in Bezug auf marginalisierte Geschlechter fortbestehen.
Eine noch weit verbreitet praktizierte Binarität von Geschlecht in männlich/weiblich wird zunehmend kritisiert und infrage gestellt. Fausto-Sterling ist eine Vorreiterin in der kritischen Betrachtung binärer Geschlechternormen und strebt es in ihrem wissenschaftlichen Werk an, Geschlechterkonzepte in ihrer Komplexität zu erfassen. Anfang der 90er-Jahre formulierte Fausto-Sterling eine Theorie der fünf Geschlechter: Drei Intersex-Kategorien, die sich auf ihre Genitalien bezogen, unterschieden und zwischen den zwei Polen weiblich und männlich positioniertseien („True Hermaphrodites“, „Male Hermaphrodites“ und „Female Hermaphrodites“).
Damit formulierte sie ein über zwei Geschlechtskategorien hinaus bestehendes Geschlechterspektrum. Mit einem nun erweiterten multidimensionalen Modell, das Geschlecht nicht auf einem Spektrum zwischen zwei Polen beschreibt, sondern als „Punkt in einem multidimensionalen Raum“, betont und visualisiert sie die Variabilität von Geschlechterdimensionen. Sie reformiert ihre vorherig aufgestellten Annahmen, auch um den Fokus auf Genitalien in der Betrachtung von Geschlechtern aufzuheben.
In einem sind die Entwicklungen sich einig: Statische Betrachtungen von Geschlecht werden der komplexen Realität nur teilweise gerecht und bedürfen einer steten Evaluation, Einordnung und Aktualisierung.
1.3 Sind Sex und Gender trenn- und austauschbar? –Ein Plädoyer für Präzision
Eine geschlechtersensible Forschungspraxis erlaubt es, Erkenntnisse zu gewinnen über den Einfluss von Geschlecht auf Physiologie und Pathophysiologie von Organismen sowie soziopsychokulturelle Faktoren und Normen, die die Entstehung und Bewältigung von Krankheit innerhalb unserer gesellschaftlichen Strukturen navigieren.
Im Deutschen vereint Geschlecht die im Englischen getrennten Dimensionen „Sex“ und „Gender“. Das birgt Gefahren und Chancen. Zu meinen besteht die Gefahr, dass Geschlecht undifferenziert betrachtet und im schlimmsten Fall als rein eindimensional deklariert wird. Im besten Fall wird durch die integrative Begrifflichkeit Geschlecht die konstante Wechselwirkung und gegenseitige Bedingung von biologischen, psychosoziokulturellen Dimensionen von Geschlecht fassbar. Eine strikte künstliche Trennung des jeweiligen Einflusses von biologischen und psychosoziokulturellen Dimensionen von Geschlecht ist bei komplexen menschlichen Organismen schwer möglich, da Umweltfaktoren mit biologischen Variablen in einem interaktiven Verhältnis stehen.
Problematisch zeigt sich, dass Sex und Gender in der biomedizinischen Literatur oft austauschbar, interchangeably, genutzt werden. Das ist zu vermeiden, insbesondere da & nbsp;– wie oben ausgeführt – sie unterschiedliche Aspekte von Geschlecht beschreiben. Für eine aussagekräftige Forschungspraxis ist eine genaue Definition der beschriebenen Dimensionen unabdingbar. Sarah S. Richardson stellt hierbei ein integratives Konzept in Bezug auf „Sex as a Biological Variable“ vor: „Sex Contextualism“. Darin plädiert sie für eine stete Reflexion darüber, wie die individuelle Zielsetzung und der zugrundeliegende Kontext der Forschung in Bezug auf die Variablen, die untersucht werden, ganz genau aussieht – und in welchen Formen „Sex“ als Variable in diesem Kontext beschrieben werden kann. Außerdem betont auch sie, dass Sex und Gender unter bestimmten Fragestellungen zwar als getrennte Ebenen in der Analyse betrachtet werden können, sie sich in der Realität allerdings nicht voneinander trennen lassen, da sie sich gegenseitig bedingen und voneinander abhängig sind. Zur adäquaten Operationalisierung sind also präzise Fragestellungen und Definitionen notwendig, um Unschärfe zu vermeiden und zeitgleich der Realität in ihrer Komplexität methodisch gerecht zu werden.
1.4 Berücksichtigung von Geschlecht in der medizinischen Praxis
Es gibt zahlreiche Beispiele über den „klassischen “Herzinfarkt hinaus, von Medikationswirkungen bis Krankheitsmanifestationen und-folgen, die den Einfluss von Geschlecht in der klinischen Praxis illustrieren. Im Folgenden sind zunächst allgemeine Beispiele und im Anschluss Erkenntnisse aus der Notfallmedizin genannt und ausgeführt.
Die Relevanz von Geschlecht in Entstehung, Erkennung, Behandlung und Verlauf von Erkrankungen ist vielfach belegt. Mauvais-Jarvis et al. beschreiben fächerübergreifend, wie sich das in unterschiedlichen Bereichen zeigt:
Der Myokardinfarkt, der sich vor allem bei Frauen auch durch andere Symptome als Brustschmerz manifestieren kann, wird bei ihnen später diagnostiziert und zögerlicher interventionell behandelt. Er stellt historisch den Beginn geschlechtersensibler Erkenntnisse in der Medizin, jedoch nur den Gipfel des Eisbergs, dar. Beispielsweise zeigt sich Rauchen als höherer Risikofaktor für Schlaganfälle bei Frauen als bei Männern und Frauenprofitieren mehr vom primärpräventiven Effekt von Aspirin bei ischämischem Schlaganfall. Die COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) zeigt beim Einsetzen der Menopause intensivierten Behandlungsbedarf durch hormonelle und damit einhergehende pathophysiologische Veränderungen. Und auch bei Infektionskrankheiten gibt es, das ist spätestens nach der COVID-19-Pandemieoffensichtlich, zu beschreibende Phänomene. Beispielsweise, dass Frauenhäufiger einen längeren und schwerwiegenderen pulmonalen Influenza-A-Verlauf zeigen als Männer durch länger anhaltende pulmonale Inflammation. Je länger und genauer in Bezug auf Geschlecht in der Medizin geforscht wird, desto breiter wird die Evidenzlage bzgl. Geschlecht als Einflussfaktor.
1.4.1 Geschlechtersensibilität in der Notaufnahme
Alyson McGregor beschreibt prägnant, wie von einem progressiven Blick in Bezug auf geschlechtersensible Notfallmedizin alle Geschlechter profitieren. Sie zeichnet das Bild einer Notaufnahme, in der unterschiedliche Fälle aufeinandertreffen und zeigt anhand von konkreten alltäglichen Beispielen und bereits gewonnen Erkenntnissen in der geschlechtersensiblen Medizin die Relevanz der Thematik auf.
Vier Bereiche werden im Folgenden näher beleuchtet. Zwei pharmakologische Beispiele, über die es sich lohnt im klinischen Alltagnachzudenken, stellen Propofol und Morphin dar. Darüber hinaus zeigen Osteoporose und Depressionen Erkrankungsbereiche auf, in denen sich ein Female Bias zeigt: Sie werden eher Frauen zugesprochen und bei Männern nicht seltenverkannt.
1.4.2 Propofol
Das aus der Gruppe der Diisopropylphenole stammende Injektionsanästhetikum Propofol ist omnipräsent. Aus dem notfallmedizinischen Alltag ist es nicht wegzudenken, aber auch in täglichen elektiven Kontexten, z.B. der Endoskopie, findet es kontinuierliche Anwendung. Frauen benötigen eine höhere Dosierung und hochfrequentere Gabe von Propofol, da sie sonst im Vergleich zu Männern früher aufwachen. Die Ursache für eine früher fallende Plasmakonzentration von Propofol kann unterdrei Gesichtspunkten diskutiert werden: schnellere Metabolisierung, raschere Verteilung in verfügbares ungesättigtes Gewebe und/oder eine langsamere Rückverteilung ins Plasma aus dem Gewebe. Ein im Vergleich zu Männern höherer Anteil an Fettgewebe scheint eine signifikante Rolle zu spielen.
1.4.3 Morphin
Morphin ist ebenso wie Propofol fester Bestandteil des klinischen Alltags. Auch hier zeigen sich signifikante geschlechterbezogene Aspekte. Eine höhere Potenz, langsamere Anflutung und längere Dauer desanalgetischen Effekts wurden bei Frauen im Vergleich zu Männern beobachtet. Eine daraus resultierende Sensibilität für einen modifizierten Bedarf bei Frauen und Männern ist zu berücksichtigen. Geschlechteraspekte in die Analyse der Problematik zu integrieren zeigt sich auch hier als relevant, insbesondere, weil Erkenntnisse aus Tiermodellen und klinischen Studien durchaus widersprüchliche Aussagen treffen. Dadurch sind Konsequenzen für die klinische Realität schwierig zu beurteilen, wenn die Untersuchung und Analyse von Geschlecht in klinischen Studien nicht ausreichend bedacht wird und so zu einer verringerten Aussagekraft für die klinische Praxis führt
Nicht nur in der Pharmakodynamik, sondern auch gesellschaftsdynamisch lohnt sich ein genauerer Blick auf Opiate. Eine steigende Tendenz an Verschreibungen und Substanzabhängigkeit wird in den USA schon lange und nun mittlerweile auch in Europa festgestellt (28; 29). Zu beobachten ist bei Frauen eine höhere Verschreibungsrate von Opiaten, häufiger ein chronischer Gebrauch undbesonders im höheren Alter vermehrte Nebenwirkungen und Medikamenteninteraktionen (30). Um vorzubeugen, dass das Ausmaß einer „Opiatkrise“ in Deutschland und Europa eskaliert und überproportional Frauen betrifft, wäre zumindest eine zeitige Selbstreflexion über die hiesige Verschreibungspraxis von Opiaten sinnvoll.
1.4.4 Osteoporose und Schenkelhalsfrakturen
Osteoporose wird weitläufig als „weibliche“ Erkrankung wahrgenommen, die vor allem postmenopausale Frauen beträfe. Aber auch Männer im höheren Alter zeigen ein erhöhtes Vorkommen, die Inzidenz bei Männern über 70 Jahren liegt bei ca. 30–40% (31; 32). Eine unzureichende Präventionslage und darausfolgende Unterbehandlung einer Osteoporose, die in Schenkelhalsfrakturen mündet, können zu weitreichenden Konsequenzen führen (1). Kannegaard et al. (33) beschreiben eine 10% erhöhte Mortalität von Männern mit Schenkelhalsfrakturen im Vergleich zu Frauen.
1.4.5 Depressionen und Suizide
Im Themenfeld der Depressionen bezieht sich das sogenannte „Gender Paradoxon“ auf Suizide und beschreibt eine drei- bis vierfach erhöhte Rate an erfolgenden Suiziden bei Männern trotz häufigerer Suizidversuche und doppelt so oft diagnostizierten Depressionen bei Frauen. Einflussfaktor ist zum einen ein historisch gewachsener und fortbestehender Female Bias in Bezug auf psychische Symptome und Diagnosen (34). So liegen beispielsweise Hinweise vor, dass Männer bei gleicher Symptomatik signifikant seltener die Diagnose Depression erhalten, die Differenzen liegen bei 10–20% (25; 35; 36; 37). Zum anderen kann ein auf stereotypen Genderrollen und -erwartungen basierendes Verhalten, das durch mangelnde Reflexion von Symptomen und fehlendem Hilfesuchverhalten gekennzeichnet ist, zu mangelnder Inanspruchnahme des Gesundheitssystems führen (38). Eine unterschiedlich gewichtete Symptomatik kann hier ein Erkennen der Depression erschweren. Frauen zeigen häufiger internalisierende Symptome (Antriebslosigkeit, traurige Verstimmung, Interessenverlust), welche weitläufigals „klassische“ Symptome der Depression gehandelt werden. Wohingegen Männer dazu tendieren, sogenannte externalisierende Symptome wie Alkohol- und Drogenmissbrauch bis -abhängigkeit, erhöhte Reizbarkeit und aggressives Verhalten zu zeigen, die seltener als Depressionssymptomatik assoziiert, klassifiziert und erkannt werden (34). Dies kann insbesondere in Akutsituationen, die aggressions- oder substanzassoziiert sind, zu Fehleinschätzungen führen, die dazu beitragen, dass Depressionen bei Männern unerkannt bleiben und schlimmstenfalls zum Suizid führen. Umgekehrt lässt sich argumentieren, dass eine erhöhte Aufklärung über erweiterte Symptome einer potenziellen Depression, vor allem bei männlich sozialisierten Personen, ein erweitertes Diagnosespektrum und so eine Suizidprävention durch rechtzeitige Depressionsdetektion möglich machen (39).
1.5 Intersektionalität
Innerhalb der sozialen Determinanten, die die Entstehung von Krankheit und Aufrechterhaltung von Gesundheit beeinflussen, existieren neben Geschlecht auch noch weitere relevante Faktoren: u.a. Rassismuserfahrungen, Alter, Behinderungen, sozioökonomischer Status, Bildungsweg, Wohnort und weitere Differenzkategorien. Es ist notwendig, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass verschiedene Diskriminierungsfaktoren den Zugang zum Gesundheitswesenund die Qualität der gesundheitlichen Behandlung maßgeblichbeeinflussen und wie sie miteinander wechselwirken (40). Diese Wechselwirkungen und Potenzierungen in Bezug auf Hürden in der gesundheitlichen Versorgung lassen sich im Konzept Intersektionalität vereinen (41). Das Konzept Intersektionalität wurde in den 1980er-Jahren von der afroamerikanischen Juristin Kimberly Crenshaw erarbeitet und ist verankert im jahrzehntelangen Engagement insbesondere afroamerikanischer feministischer Bewegungen (41; 42). Crenshaw argumentiert, dass durch die Wechselwirkung von Rassismus und Sexismus eine neue Form der Diskriminierungsrealität entsteht, die sich von singulär betrachtetem Sexismus oder Rassismus unterscheidet. Eine Schwarze Frau erlebe eine andere Diskriminierungsrealität als eine weiße Frau oder ein Schwarzer Mann (41). Intersektionalität geht über eine lineare Analyse von Unterdrückungsmechanismen und Ungerechtigkeitssystemen hinaus und strebt eine übergreifende und gleichberechtigte Analyse von Ungleichheitssystemen an (43). Es reicht nicht, Diskriminierungsfaktoren lediglich getrennt voneinander zu betrachtenund aufzuaddieren, sondern bedarf einer simultanen Analyse einer eigenen Diskriminierungsentität (44).Wie kann eine intersektionale Betrachtung im klinischen Alltag aussehen? Verdeutlichen lässt sich das beispielsweise anhand von Erkenntnissen zu Gebärendensterblichkeit und die COVID-19-Pandemie in den USA. Bezüglich Gebärendensterblichkeit konnte 2016–2017 eine bis zu 3,5-mal höhere Mortalität von Schwarzen, nicht hispanischen Frauen im Vergleich zu weißen, nichthispanischen Frauen beschrieben werden. Das zeigt die Verzahnung der Diskriminierungsfaktoren Rassismus und Sexismus auf (45). Während der COVID-19-Pandemie war der Vergleich der Mortalität ebenso bezeichnend: Schwarze, Hispanoamerikaner:innen, und Amerikaner:innen asiatischer Abstammung zeigten eine höhere Mortalität im Vergleich zur weißen Population. Wichtig zeigten sich für dieses Missverhältnis auch sozioökonomische Gründe, z.B. der höhere Anteil an Berufen, die in Person ausgeübt werden mussten und lange Arbeitswege. Schwarze Männer zeigten eine höhere Mortalitätsrate als Schwarze Frauen, und weiße Männer und Frauen u.a. durch eine höhere Prävalenz an kardiovaskulären Erkrankungen in Schwarzen US-amerikanischen Männern in der analysierten Region. Hier zeigt sich Geschlecht in einer dichten Verzahnung zu klassistisch/sozioökonomischen und rassistisch bedingten Variablen (46). Das sind zwei Beispiele von vielen, die verdeutlichen, dass auch innerhalb geschlechtersensibler Medizin eine isolierte Betrachtung von Geschlecht nicht ausreicht. Geschlecht ist eingebettet in soziokulturelle Gegebenheiten. Eine Kontextualisierung und gleichberechtigte Betrachtung anderer Differenzmerkmale sind zwingend notwendig, um eine Gesundheitsversorgung sicherzustellen, die für alle Barrierefreiheit und eine hohe Qualität sicherstellt. Eine eindimensionale Betrachtung greift – wie so oft – zu kurz.
Take home messages:
Eine Veränderungspraxis, die in alle Bereiche des Gesundheitssystems Einzug findet und als differenzierte Formate strukturell implementiert ist, ist notwendig, um eine geschlechtersensible, diskriminierungsfreie medizinische Praxis nachhaltig zu sichern. Dafür braucht es Ressourcen in der Forschung, um eine solide Evidenzbasis zu kultivieren und daraus informierte klinische Leitlinien zu entwickeln. Auf aktuellen Erkenntnissen beruhend, muss eine Sensibilisierung in Aus‑, Weiter- und Fortbildung aller Akteur:innen im Gesundheitswesen durch flächendeckende Verankerung im Pflichtcurriculum stattfinden. Und Patient:innen können durch Aufklärungskampagnen auch außerhalb der medizinischen Behandlung über ihre individualisierten Bedarfe aufgeklärt werden. Ein interprofessionelles und interdisziplinäres Miteinander aller Bereiche ist elementar, um gemeinsam Wege zu finden, eine gerechte Gesundheitspraxis zu gestalten. Eine bundesweite und internationale Vernetzung ist für diese Zielsetzung unabdingbar.
Geschlechter- und diskriminierungssensible Forschung, Lehre und Behandlung sind notwendig für eine qualitativ hochwertige medizinische Praxis, die die Gesamtbevölkerung abbildet und adäquat behandelt. Sie ist ein Qualitätsmerkmal einer gerechten medizinischen Versorgung, die insbesondere in Notfallsituationen teilweise über Leben und Tod entscheiden kann.
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem "DIVI Jahrbuch 2023/2024" herausgegeben von Stefan Kluge, Michael Sander, Felix Walcher und Thorsten Brenner. Alle Informationen zum Titel erhalten Sie hier.

 Health Care Management
Health Care Management