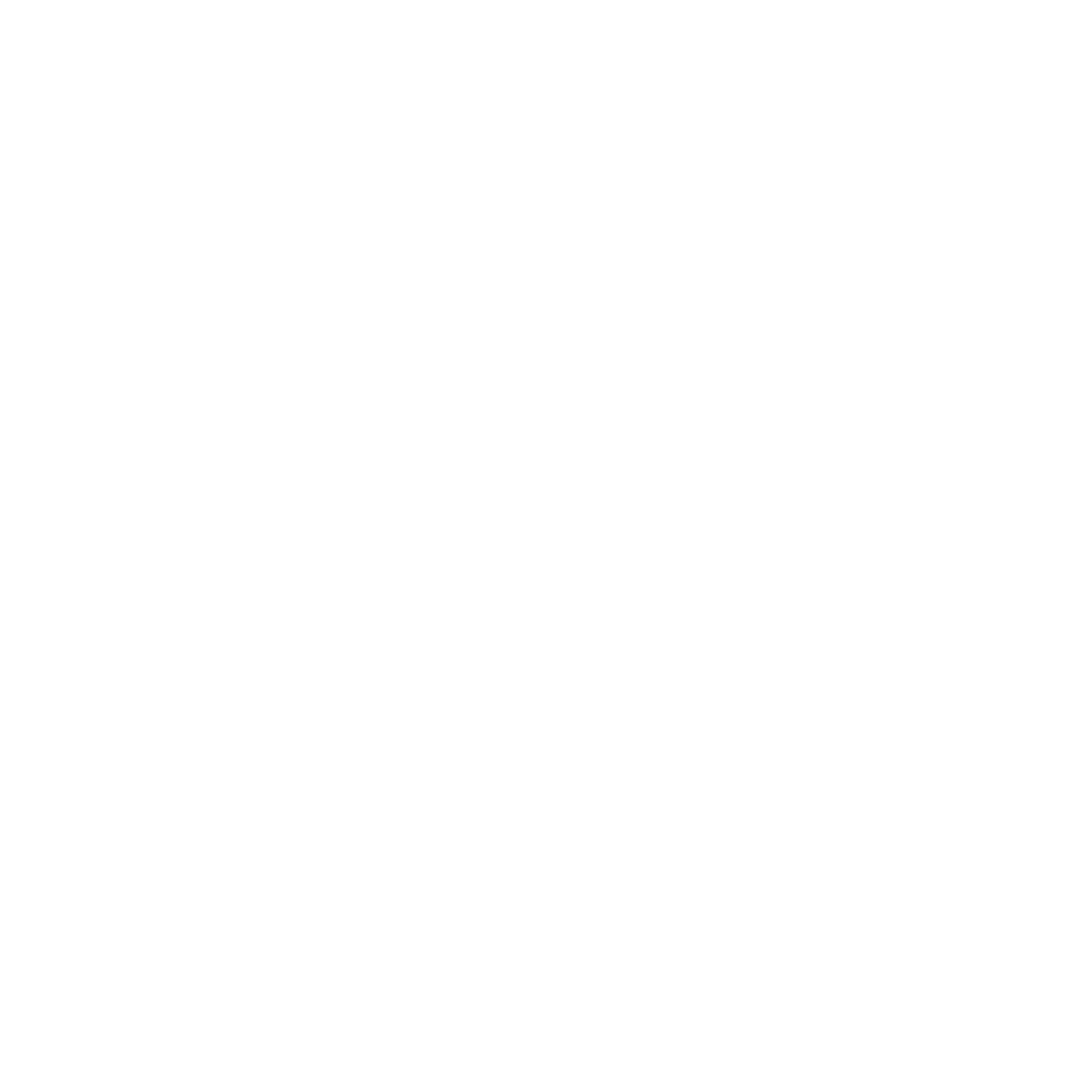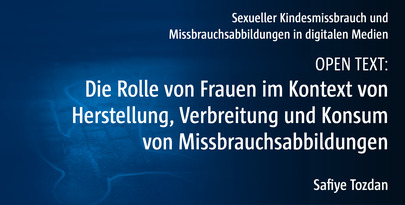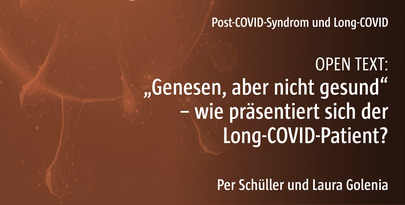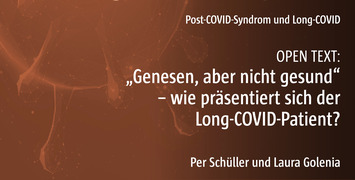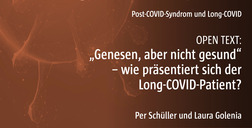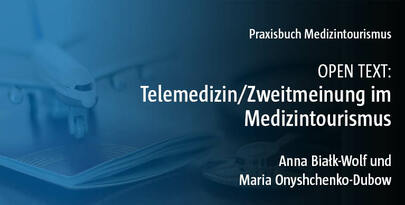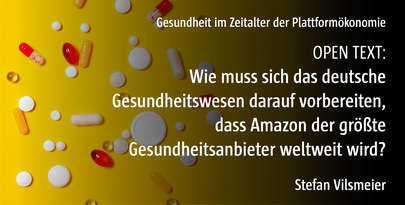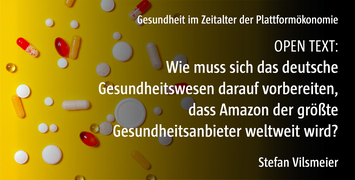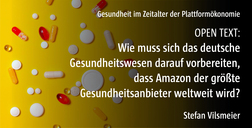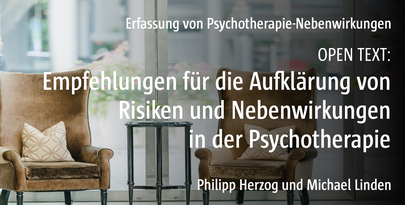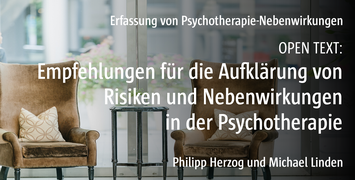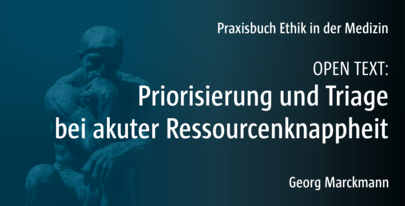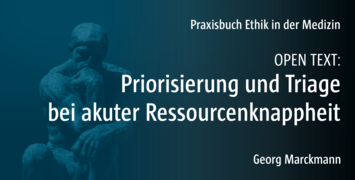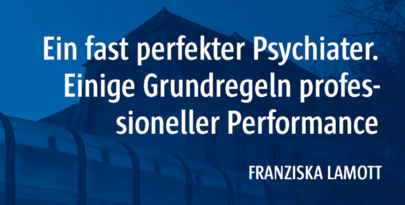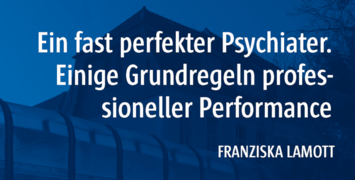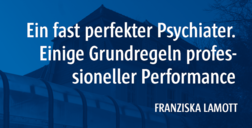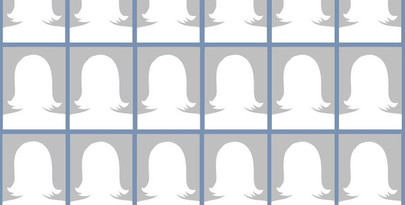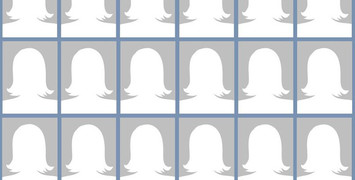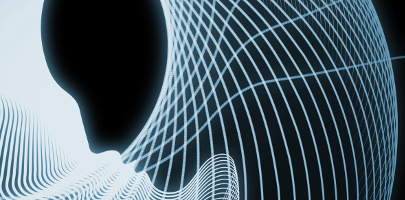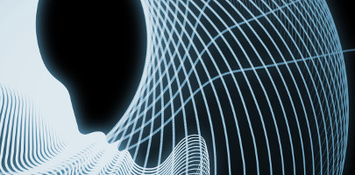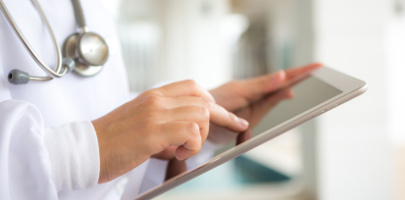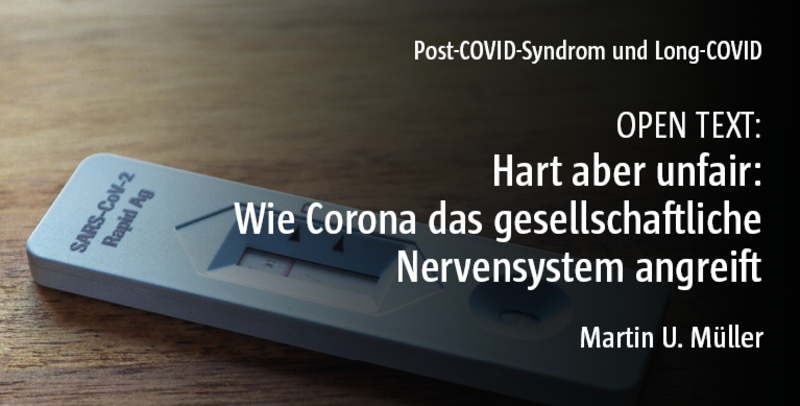
Hart aber unfair
Wie Corona das gesellschaftliche Nervensystem angreift
Martin U. Müller
Ich wage eine These zu Beginn, die viele von Ihnen verschrecken wird: Von der Coronavirus-Pandemie wird mit einigem zeitlichen Abstand – ich denke da an ein Jahrzehnt – kaum mehr als eine Fußnote übrigbleiben. Die Geschichtsbücher werden die Zeit kurz erwähnen, zwei Absätze vielleicht. Denn der Mensch ist vergesslich. Das sagen Tourismusexperten, wenn sie nach einem Terroranschlag am Badestrand gefragt werden, ob jemals wieder Urlauber kommen werden. Angesichts des Leids und der schrecklichen Bilder scheint das in dem Augenblick nahezu ausgeschlossen. Doch nur zwei Jahre später erinnert sich kaum mehr jemand daran. Gewiss, ein isoliertes Ereignis in einem Badeort und eine schreckliche Pandemie dieser Ausprägung sind schwer miteinander zu vergleichen.
So hinterlässt auf einer individuellen Ebene SARS-CoV-2 auch tiefe Narben. Es werden die Toten bleiben, mehr als 6,5 Millionen Menschen derzeit, die das Virus umgebracht hat, weil es biologisch hinterhältig ist: Es ist ansteckend, aber nicht extrem. Es ist tödlich, aber nur für einen kleineren Teil der Kranken. Es kann asymptomatische Verläufe verursachen und es agiert erratisch – wir können nicht genau sagen, wen schwere Komplikationen treffen und wen nicht. Es wird Teil von Familiengeschichten bleiben: Oma, Onkel, Mutter, Bruder, das Baby, der Nachbar, die Arbeitskollegin, die ihr Leben verloren haben. Die Coronavirus-Pandemie hat fassbarer gemacht, wie eng Glück und die Kürze und Zerbrechlichkeit des Lebens beieinanderliegen, durch die von ihr verursachte Allgegenwart von Tod und Trauer.
Wir werden weiter damit leben müssen, es wird in unser kollektives Verständnis von Krankheiten eingehen, die uns bedrohen – vermutlich dauerhaft. Denn weil Medien und Gesellschaft einen relativ scharf umrissenen Starttermin der Pandemie verkündeten, rechneten Viele lange Zeit auch mit einem Enddatum. Die Schweizer Virologin Isabella Eckerle formulierte es auf Twitter so (https://twitter.com/eckerleisabella/status/1538477699294953473?s=21&t=Rg2j3480yiCnOR6CjEkpjQ):
„Der Tag, an dem wir uns alle in den Armen liegen, das Virus verschwunden & alles wieder wie vorher, oder sogar noch besser wird. Wir sollten langsam anerkennen, dass dieser Tag nicht mehr kommen wird. #SARSCoV2 #COVID19 wird bleiben, genauso wie regelmäßige Infektionswellen & Longcovid, es wird sich nicht über Nacht in das 5. endemische Coronavirus verwandeln & lässt sich nicht ignorieren (...).“
Doch auf einer gesellschaftlichen Ebene wird sich weniger einbrennen, als wir heute denken. Vielmehr hat das Virus den Status quo schonungslos offengelegt, was aber nicht zwangsläufig Veränderungen mit sich zieht. Wir werden weiterhin auf China angewiesen sein, wenn es um die Versorgung mit medizinischen Verbrauchsgütern geht. Die Öffentlichkeit erkennt, dass es schwierig ist, wenn Schnelltests oder Schutzmasken hauptsächlich aus China kommen. Und doch bleibt das wichtigste Kriterium bei einer öffentlichen Ausschreibung für derlei Dinge nicht etwa die Herkunft, sondern der Preis.
Pflegekräfte und Beschäftigte in anderen sozialen Berufen werden auch in Zukunft nicht zu den Spitzenverdienern gehören, auch wenn in der Krise Einigkeit darüber herrschte, dass die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen besser werden müssen.
Wir werden wieder unbeschwert in Restaurants sitzen, ferne Länder bereisen und auf Kreuzfahrtschiffen am Buffet anstehen, die wir auf dem Höhepunkt der Pandemie noch als „schwimmende Petrischalen“ bezeichnet haben.
Hatte der Angriffskrieg auf die Ukraine binnen Tagen drastische Folgen wie eine Abkehr von russischen Rohstoffen, massive Investitionsvorhaben in schweres Kriegsgerät bei der Bundeswehr, einen Zusammenbruch über Jahrzehnte gewachsener Wirtschaftsbeziehungen und einem Zusammenrücken der westlichen Welt, haben mehr als zwei Jahre Coronavirus keine so deutlichen Spuren hinterlassen.
Es haben sich vielmehr ohnehin vorhandene Unterschiede zwischen Staaten, Gesellschaftsvorstellungen und Ideologien herausgebildet. Auf der einen Seite Länder wie China, die mit einer Art elektronischen Fußfessel Infizierte in Isolation hielten und Hunderttausende zu Massentests zwangen, wenn eine Handvoll neuer Infektionen aufgetreten sind. Daraus resultierten auch Absurditäten, wie etwa diese hier: Eine Frau war in der chinesischen Stadt Zhengzhou mit einem Mann auf ein Date verabredet. Er wollte für sie kochen. Als sich das Treffen dem Ende näherte, initiierten die Behörden eine Ausgangssperre. Die Frau musste bleiben – tagelang. Sie verbreitete mehrere Videos von der Situation, die wiederum in Medien auf der ganzen Welt aufgegriffen wurden. Gefangen in der Wohnung des Dates.
Und auf der anderen Seite stehen Länder wie Deutschland, die darum ringen, ob Warn-Apps personenbezogene Daten verarbeiten dürfen oder ob die Registrierung mit biometrischen Merkmalen für ein Gurgeltest-System ein Angriff auf die informationelle Selbstbestimmung ist. Eine der merkwürdigsten Geschichten der Pandemie aus der analogen Welt: Weil ein Gesundheitsamt mit der Verarbeitung der nicht digitalen Meldungen der Infizierten kaum hinterherkam, entschloss man sich, die Zahl der Neuinfektionen mittels einer Waage zu schätzen. Die Meldungen kamen per Fax – wissend, wie viel eine Seite etwa wiegt, konnte so eine erste Hochrechnung erfolgen, ohne dass jemand hätte zählen müssen. Arbeiten unsere Gesundheitsämter nach zwei Jahren Pandemie erheblich digitaler als vorher? Eher nicht, sagen Insider.
Journalisten sprechen gern floskelhaft von einem „Brennglas“, wenn eine Entwicklung ohnehin vorhandene Dinge sichtbarer macht. Und genau das ist auch in der Pandemie bisher passiert. So hat die Coronakrise etwa ohnehin vorhandene Gräben zwischen Arm und Reich gezeigt. Nun ist in Deutschland das oberste „ein Prozent“ der Bevölkerung innerhalb seiner Gruppe wahrscheinlich in Sachen Lebensstil weiter auseinander als die restlichen 99 Prozent der Bevölkerung. Es gibt „arme Reiche“, die gar nicht fassen können, statistisch dazuzugehören und so reiche Menschen, die keinerlei Überblick darüber haben, wie viel Vermögen ihnen gehört. Der folgende Abschnitt soll daher so verstanden werden, wie er gemeint ist: überspitzt. Wahrscheinlich gab es in Deutschland mehr als 83 Millionen verschiedene Realitäten und Wahrnehmungen, wie die Pandemie bisher verlaufen ist. Wie in anderen Phasen eines menschlichen Lebens auch. Und eines sei auch hier gesagt – verändern wird die in der Krise abermals gewonnene Erkenntnis, dass es in der Gesellschaft ungleich zugeht, am Fakt selbst kaum etwas.
Die Reichen in der Krise
Begonnen, sofern man das überhaupt seriös sagen kann, hat die Coronavirus-Pandemie in Deutschland etwa in Hamburg-Winterhude, in Straßen mit großen Bäumen, weißen Fassaden und modernen Sicherheitskameras vor der Tür. Die Straßen heißen Blumenstraße, Agnesstraße, Leinpfad oder Sierichstraße. Es leben hier Millionäre, Milliardäre, Fernsehstars, Erben. Nirgendwo in Deutschland gibt es mehr Skiklubs als in Hamburg und so passt es auch, dass die Schüler der Hansestadt „Ski-ferien“ haben. Und in diesen Skiferien fahren die Reichen nach Lech oder Ischgl, St. Moritz oder Davos. Es verbreitete sich schnell in diesen Straßenzügen, dass ein bekanntes Fernsehgesicht zu den ersten Corona-Infizierten gehörte, angesteckt in Ischgl. In den Medien war bis dahin von diesem Promi-Fall nichts bekannt. So infektionsanfällig die Bewohner dort durch ihre Reisen zunächst waren, waren sie später privilegiert. Sie konnten in ihren weiträumigen Anwesen auf Abstand gehen, haben Gärten, mehrere Schlafzimmer, manchmal ein Schwimmbad.
Verreisten sie trotzdem, buchten sie Tickets in der First Class oder charterten gleich einen Privatjet. Seit Corona boomt das Geschäft mit den teuren Jets – und dass, obwohl Firmenreisen weniger geworden sind. Anbieter berichten, dass die meisten Kunden wohlhabende Privatpersonen seien, die mit mehr Privatsphäre (und damit Infektionsschutz) in den Urlaub fliegen wollen. Und auch die kommerzielle Luftfahrt erlebt über Corona einen Luxus-Boom. Lufthansa-Chef Carsten Spohr berichtet davon, dass mehr Champagner geladen werden muss, weil schon tagsüber mehr denn je davon geordert werde (https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-chef-carsten-spohr-ueber-die-krise-der-airlines-der-champagnerkon-sum-nimmt-zu-a-61902157-2ce9-4fc5-9db6-eff374276dd3). Das teuerste Ticket im Kranich-Konzern kostet bis zu 22.600 Euro für einen Hin- und Rückflug von Frankfurt nach San Francisco. Spohr gab eher beiläufig zu Protokoll, dass selbst für diese Summe auf der Strecke kein Ticket mehr zu bekommen sei (https://www.spiegel. de/wirtschaft/lufthansa-fliegt-man-mit-den-deutschen-wirklich-noch-first-class-a-d2dcd6d6-a8be-4f59-a395-37fccd00aa75).
Geschlossene Kindergärten spielten kaum eine Rolle, im Zweifel kümmerte sich die Hausangestellte um den Nachwuchs oder unterstützte beim Homeschooling. Die Baustellenabsperrungen wurden schnell mehr, denn so konnte man die Zeit wenigstens sinnvoll mit Umbauarbeiten nutzen. Und währenddessen flüchtete man ins Ferienhaus. Problem hier: Zwar durfte man als Zweitwohnsitz-Besitzer etwa auf die gesperrte Insel Sylt fahren, doch viele Restaurants hatten zu. Was also tun, ohne Dorfkrug, Rauchfang oder Sansibar? Immerhin: Der Autoreisezug war leer.
Manche von denen, die kein Ferienhaus ihr Eigen nennen konnten, nutzten die Hochzeit der Pandemie für den Kauf. „Gerade wurde ein Friesenhaus im Nobelort Kampen verkauft. Jahrelang hatten sich verschiedene Makler die Zähne ausgebissen, einen Käufer für das baufällige Anwesen zu finden. Jetzt zahlte ein Käufer zehn Millionen Euro – und kam dafür noch nicht mal auf die Insel. Ein Handyvideo genügte ihm für die Kaufentscheidung“, beschreibe ich die Lage auf Sylt (https://www.spiegel.de/wirtschaft/auslands-immobilien-boom-gesucht-ferienhaus-mit-pool-preis-egal-a-566da55b-0002-0001-0000-000178959729).
Angst um seine Einkommensquellen hat in den genannten Straßen in Hamburg kaum jemand. Bei Festen, zu denen man weiterhin geht, wird der Winston Churchill zugeschriebene Satz „Never Let a Good Crisis Go to Waste“ gern zitiert – warum nicht jetzt einen klammen Konkurrenten kaufen? Es herrsche ja schließlich Anlage-druck. Mitleid erwecken allenfalls die Friseure, die nun Haare gegen ein üppiges Trinkgeld zu Hause schneiden oder der Masseur, der darüber jammert, sich impfen lassen zu müssen, um weitermachen zu dürfen. Apropos Impfung: Auch hier waren die Bewohner im Vorteil. Fast jeder kannte jemanden, der gute Drähte in eine Arztpraxis hatte, die ihn oder sie unabhängig von Vorerkrankungen bei der Impfstoffvergabe bevorzugte.
Ein bekannter Rechtsanwalt prahlte gar damit, ein „eigenes Intensivbett“ vorreserviert zu haben. Schließlich kenne er den Klinikboss. Es schien so, als glaube er daran sehr ernsthaft.
Die Armen in der Krise
In der Möwenstraße, zwischen der Blumen- und der Agnesstraße, wohnt eine ältere Dame seit Beginn der Pandemie. Sie hat nur wenige Quadratmeter zur Verfügung – ihr Zuhause ist ein Ford Fiesta. Der Zweitürer hat Rostflecken, sie hat ihn am Straßenrand abgestellt. In der Scheibe hängt ein Zettel: Wegen der Coronakrise warte sie auf einen Katalysator – angeblich. In Wirklichkeit lebt sie wohl eher seit langer Zeit in ihrem Auto. Gelegentlich muss sie es umparken (was in dem Fall eher schieben bedeutet), wenn etwa Baumarbeiten anstehen. Sie schläft auf der winzigen Rückbank, hat ein kleines Wägelchen, mit dem sie sich tagsüber durch die Gegend bewegt. Einmal, so erzählt sie es, kam die Polizei. Ein Anwohner habe die alarmiert, weil er dachte, sie sei bewusstlos – dabei habe sie nur geschlafen. Der Grund, warum die Frau im Auto mit dem Heidelberger Kennzeichen lebt, ist etwas nebulös. Und doch steht sie wahrscheinlich für den größtmöglichen Gegensatz zu ihrer Nachbarschaft. Sie hat keinen Rückzugsort, kann direkt am Auto kein Vollbad nehmen und ich habe sie auch nie mit einer Maske gesehen.
Morgens laufen in der Gegend auffallend viele Frauen an dem brokatroten Ford vorbei – sie gehen zur Arbeit in Haushalten, putzen dort, wässern die Gärten, führen Hunde aus. Auch in der Hochzeit der Pandemie kamen sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, einfach, weil sie wirtschaftlich mussten. Es gab für sie keine Überbrückungshilfen. Ihre Kinder mussten sich derweil allein dem Online-Unterricht ihrer Schulen anschließen – sofern sie denn einen dafür geeigneten Internetzugang hatten.
Waren anfangs diese Gruppen von Menschen vor Corona noch relativ geschützt, weil sie eben nicht in Ischgl oder Lech in den Skiferien waren, schlug das Pendel um. U-Bahn statt Privatjet, Enge statt Abstand, Zwei-Zimmer-Wohnung statt Garten und keine Handynummer eines Arztes, der mal eben noch eine Impfdosis für die ganze Familie locker macht. Und dann ist da noch die Existenzangst. Kann ich auch morgen noch in dem Haushalt arbeiten? Ein Fensterputzer beschrieb es so: Die Aufträge seien dramatisch eingebrochen, weil kaum mehr jemand fremde Personen, die nicht unbedingt kommen müssten, im eigenen Haus haben wollte. Er senkte die Preise. Und was ist erst mit Personen, die sich nicht legal in Deutschland auf-halten? Eine neue Stelle inmitten einer Pandemie zu finden – das dürfte für sie eher schwierig sein.
Masken kosteten auf dem Höhepunkt der Krise mehrere Euro – das Stück. Ein Express-PCR-Test, um möglichst bald Gewissheit zu haben, weit über hundert Euro. Schwer erreichbar mit einem Stundenlohn von um die 13 Euro. Dass sozioökonomische Benachteiligungen unabhängig voneinander mit der Inzidenz von Covid-19 verbunden sind, zeigte eindrucksvoll eine im zu „The Lancet“ gehörenden Magazin „EClinical Medicine“ veröffentlichten Untersuchung (https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(22)00215-2/fulltext#%20). Die Autoren schreiben:
„Dies deutet darauf hin, dass ‚besser gestellte‘ Bevölkerungsgruppen für die ersten Übertragungen verantwortlich waren, während in den nachfolgenden Phasen weniger privilegierte Gruppen ein höheres Infektionsrisiko aufwiesen. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die ‚Bessergestellten‘ bzw. die am wenigsten Benachteiligten in den ersten Phasen häufiger internationalen Reisen ausgesetzt waren, während die weniger Privilegierten weniger Möglichkeiten zur Selbstisolierung und zum Home-Office hatten und häufiger in kontaktintensiven Bereichen arbeiteten. Das Ausmaß des bereinigten Zusammenhangs zwischen Deprivation und Covid-19-Inzidenz nahm über die drei Wellen hinweg zu.“
Warum sich Geistes- und Naturwissenschaftler in der Krise nicht verstehen
Eine wichtige Funktion in der Vermittlung neuer Erkenntnisse über das Virus, Schutzmaßnahmen und staatliche Eingriffe übernehmen in solchen Großlagen nach wie vor die Massenmedien. Sie müssen sich behaupten gegen Telegram- oder WhatsApp-Gruppen, Facebook- und TikTok-Postings, die viral den Weg zu ihren Nutzern mit nicht immer seriösen Informationen finden. Und manchmal kam in den vergangenen Monaten auch den Informationsprofis, Journalistinnen und Journalisten, die Orientierung abhanden. Was auch an ihrem Ausbildungshintergrund liegen kann.
Maske, ja? Maske, nein? FFP2-Maske, medizinischer Mund-Nasen-Schutz, „Alltags-maske“ oder gar FFP3-Standard? Am Anfang der Pandemie ging es munter hin- und her. Mal brachten Masken kaum was, dann wieder waren sie die Säule im Pandemieschutz schlechthin. Ähnliches passierte mit der Empfehlung einer strikten Handdesinfektion. Oder der Luftdüse im Flugzeug: auf oder zu?
Nicht jeder verstand den Wankelmut, die sich widersprechenden Empfehlungen im Wochentakt, auch nicht alle Journalisten und Politiker. Naturwissenschaftler hingegen sind es gewohnt, dass neue Studienerkenntnisse jahrelang sicher geglaubte Grundsätze über den Haufen werfen können. Lehrte man einst bei der Laien-Herz-Lungen-Wiederbelebung, dass auf zwei Atemspenden 15 Thoraxmassagen folgen, waren es nach neuerer Forschung plötzlich 30 Massagen und dann erst zwei Atemstöße.
Weil nun aber ein Großteil der Politiker wie Journalisten keine naturwissenschaftliche Ausbildung haben, kam es nicht selten in der Pandemie zu Missverständnissen. „Können die sich nicht mal festlegen?“, hieß es da mal in Zeitungskommentaren. Die Wissenschaft wiederum verstand die Kritik an ihrem Handeln nicht – weil sie wiederum zwar den steten Wandel von Erkenntnissen kennt, diesen aber nicht immer breitenverständlich erklären konnte oder wollte.
„Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft, und die Politik ist weiter nichts als Medizin im Großen“, sagte Rudolf Virchow einst. Und doch scheinen bis heute beide Bereiche nicht nur sehr unterschiedliche Sprachen zu sprechen, sondern auch höchst unterschiedliche Zugänge zum Thema zu haben. Auch das sorgte für eine fehlende Dimension in der Bewältigung der gesellschaftlichen Folgen der Pandemie.
Thesen
- Die gesellschaftlichen Beharrungskräfte sind größer, als eine Pandemie des Ausmaßes des Coronavirus sie verändern könnte. „Eine Pandemie kann gesellschaftliche Entwicklungen deutlicher als je zuvor machen, das heißt aber nicht, dass daraus Veränderung folgt.
- Die Wissenschaftskommunikation hat massiven Nachholbedarf, sich breitenverständlich Gehör zu verschaffen und vor allem ihre Methoden auch Menschen zu erklären, die nicht primär naturwissenschaftlich denken. Dazu zählen auch weite Teile der Politik.
- Um eine Pandemie auch gesellschaftlich gut zu überwinden, muss interdisziplinär auf die Folgen geschaut werden. Eine Einengung, etwa nur auf Experten der Virologie – auch wenn sie völlig zutreffende Dinge sagen – führt dazu, dass ganze Problemfelder keine breite Wahrnehmung in der Öffentlichkeit erfahren.
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch "Post-COVID-Syndrom und Long-COVID" herausgegeben von Dr. med. Jördis Frommhold und Dr. med. Per Otto Schüller. Alle Informationen zum Titel erhalten Sie hier.

 Health Care Management
Health Care Management