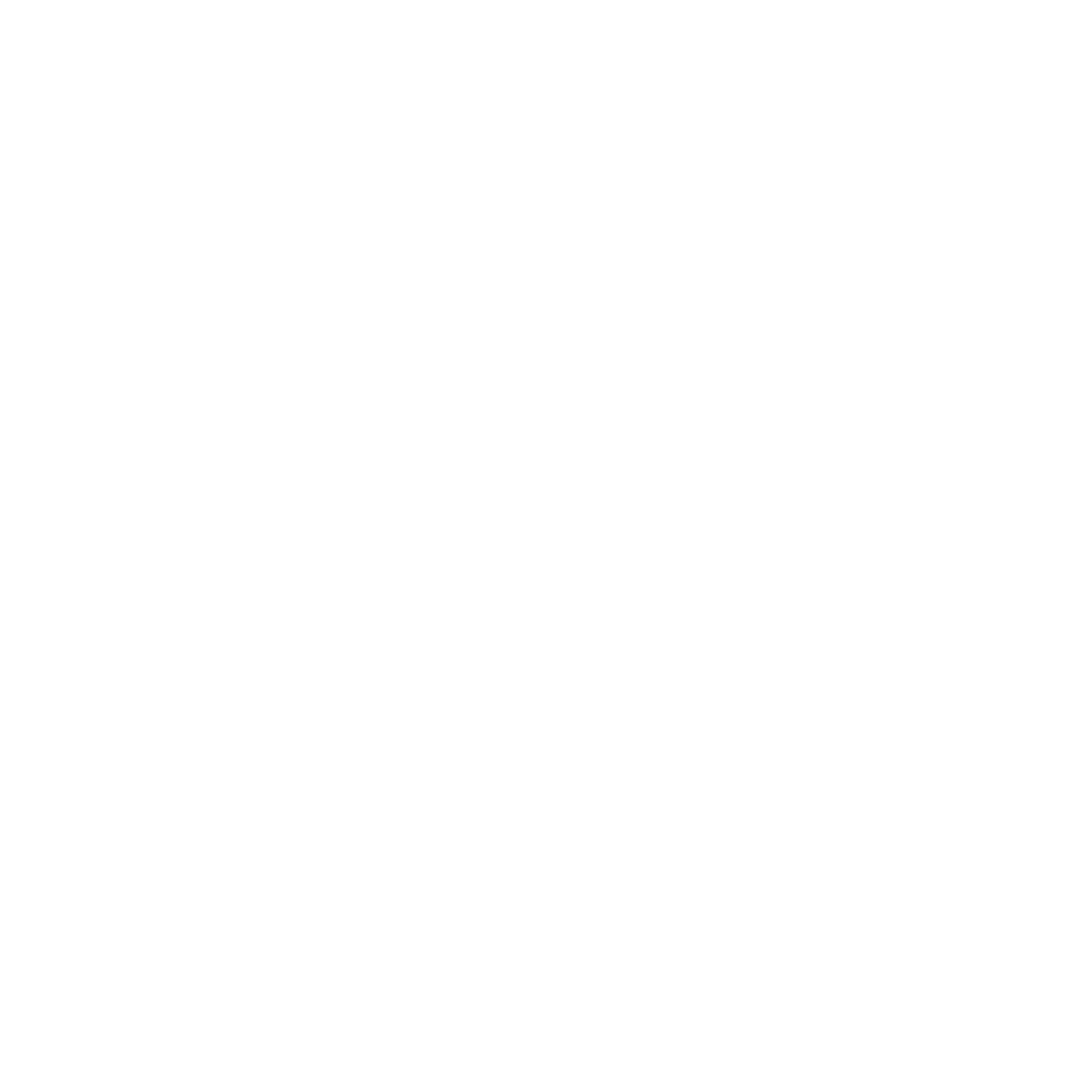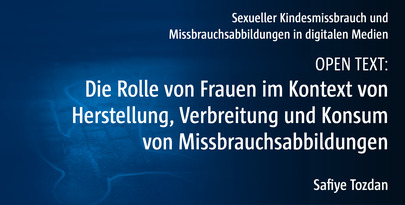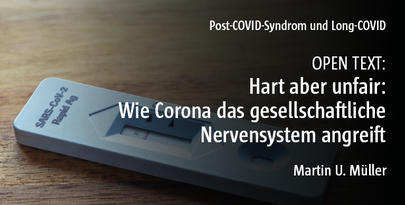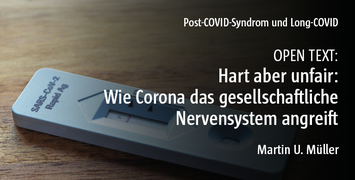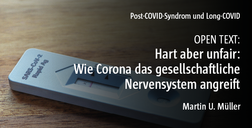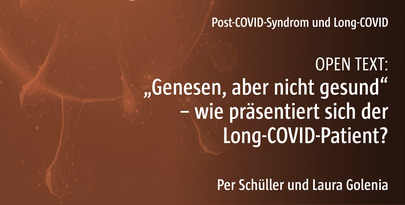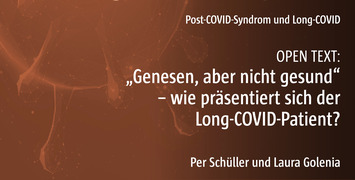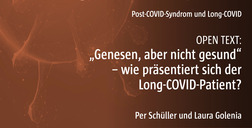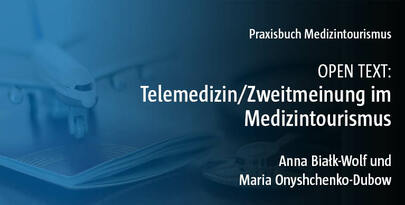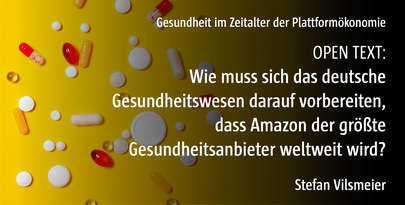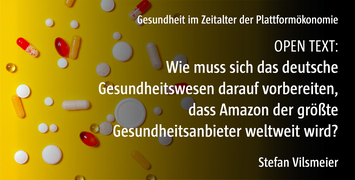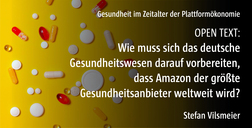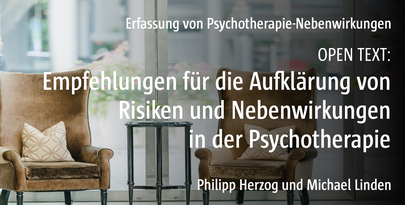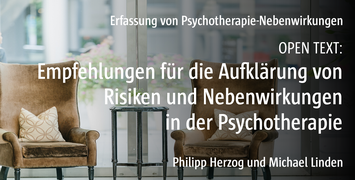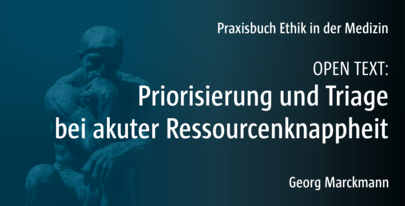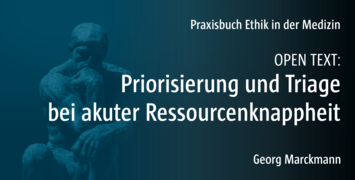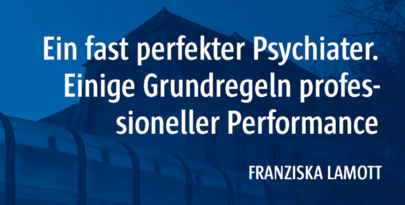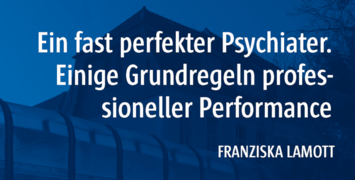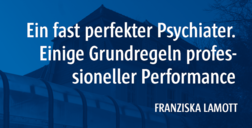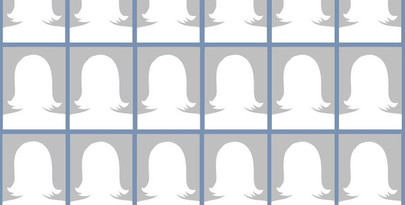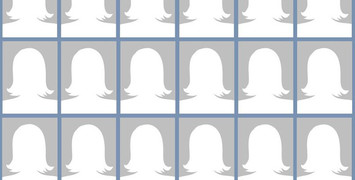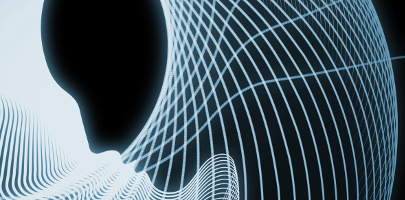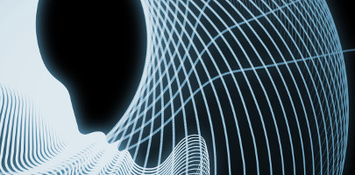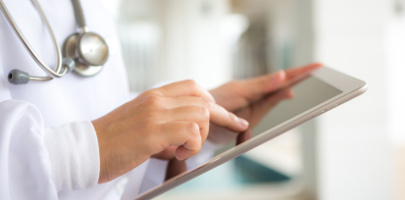Breaking the glass ceiling
Breaking the glass ceiling: Gleichstellung in der Klinik
Laura Jung, Annika Kreitlow und Sophie Gepp
“Kein erheblicher Nutzen für die Kranken, mehr Schaden als Nutzen für die Frauen selbst, mindestens kein Nutzen für die deutschen Hochschulen und die Wissenschaft, [und] eine Minderung des ärztlichen Ansehens”(Penzoldt 1898)
Zu diesem nüchternen Schluss kommt Franz Penzoldt, Direktor der Erlanger Medizinischen Klinik, beim 26. Deutschen Ärztetag 1898 in seiner ausführlichen Antwort auf den politischen Vorstoß das Medizinstudium auch für Frauen zu öffnen. Viel Erfolg hat er mit seiner Argumentation allerdings nicht. Trotz des Widerstandes der männlichen Kollegen konnten ab1901 die ersten Frauen in Deutschland die medizinische Staatsexamensprüfung ablegen. 1919 habilitierte mit Dr. Adele Hartmann dann erstmals auch eine Frau in der Medizin. Ein Meilenstein – vorbei ist die Diskussion um Gleichberechtigung an deutschen Kliniken und Lehrstühlen damit aber noch lange nicht.
Wer sich heute im Hörsaal einer medizinischen Fakultät umschaut, wird feststellen, dass es sich beim überwiegenden Teil der Studierenden um junge Frauen handelt. Seit Jahren hören wir “die Medizin wird weiblich” und manch einer fragt sich schon, ob vielleicht eine Männerquote beider Studienzulassung benötigt wird. Doch spätestens beim Blick in die Klinikverschiebt sich das Geschlechterverhältnis schnell wieder, zumindest wenn man über die Assistenzärzt:innen stellen hinaus schaut:
Im Jahr 2019 waren über 60% der Medizinstudierenden weiblich (Statistisches Bundesamt 2021), doch in den sogenannten “Spitzenpositionen” (Lehrstuhl/ Klinikdirektion/ unabhängige Abteilungsleitung) herrschte nur ein Frauenanteil von knapp 13% (Deutscher Ärztinnenbund 2019).Und nicht nur bei den Führungspositionen, auch bei der Anzahl von wissenschaftlichen Publikationen und Repräsentation in Redaktionen von Fachzeitschriften sind Frauen häufig benachteiligt (Jagsi et al. 2008).
Bestimmte Fachrichtungen scheinen auf den ersten Blick generell wenig attraktiv für Frauen: Während in der Gynäkologie und Geburtshilfe 2020 ein Frauenanteil von knapp 70% herrschte, kam die Anästhesiologie auf 44% und die Chirurgie sogar nur auf 22% Ärztinnen. Dass diesen geringen Zahlen systemische und institutionelle Hürden für Frauen gegenüberstehen, die man analysieren und beseitigen sollte, scheint dabei noch nicht allen in den Sinn zu kommen. CDU-Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Claudia Schmidtke forderte stattdessen gar die Einführung einer Männerquote für das Medizinstudium, um die Chirurgie nicht vor ein Nachwuchsproblem zu stellen (Bruhns 2018). Der Glaube, dass Männer generell bessere Chirurgen seien, ist offenbar auch im 21. Jahrhundert noch präsent. Und praktischerweise haben die männlichen Kollegen auch keine tickende biologische Uhr, die ihren Karrieren im Wege steht. Die modernen Argumente stehen in einer Linie mit Penzoldts Referat von 1898.
1. Barrieren von Beginn an
Macht man sich tatsächlich die Mühe der Ursache für die fehlenden Frauen in Führungspositionen und chirurgischen Fächern auf den Grund zu gehen, zeigt sich ein anderes Bild. Häufig liegt es nicht an den Frauen, die nicht wollen; sondern an dem System, dass sie nicht lässt, bewusst und unbewusst ausgrenzt und bereits ab dem Medizinstudium benachteiligt. Geschichtlich betrachtet handelt es sich bei unserem Gesundheitssystem um ein vorrangig von Männern konstruiertes System. Es beruhte ursprünglich darauf, dass Männer in der klinischen Versorgung tätig sind, während Frauen ihnen durch Care-Arbeit den Rücken freihielten, oder sie als Krankenschwester in der Klinikunterstützen. Nacht- und Wochenenddienste, Arbeiten an Feiertagen und sehr begrenzte Halbtagsmodelle erschweren die Familienvereinbarkeit. Hinzu kommt, dass bei Frauen die Jahre der Familienplanung (zwischen 25 und 40 Jahren) oft stark mit den Jahren der Fachärzt:innenweiterbildung, der möglichen Habilitation oder weiteren Karriereschritten, auch “Rush-Hour des Lebens”(Lothaller 2009) genannt, kollidieren. Doch es liegt nicht nur am Timing und der Familienplanung, sondern auch daran, wer überhaupt befördert wird. Ein auch als “Thomas-Kreislauf” bekanntes Phänomen zeigt, dass Männer gerne Männerunterstützen und tendenziell eher Personen, die ihnen ähnlich sind für Professuren oder Beförderungen auswählen (Koopmann 2021). Frauen haben oft Schwierigkeiten in solche Netzwerke hineinzukommen und profitieren daher seltener vom “Wohlwollen” der Alteingesessenen. Es fehlt an Mentorinnen, die ihnen die Tür aufhalten könnten.
Gleichzeitig gibt es bewusste und unbewusste Vorurteile oder Erwartungen, die mit dem Geschlecht zusammenhängen. So sind Eigenschaften, die mit Führungskräften in Verbindung gebracht werden, häufig “männlich” konnotierte Charakteristika. Der Mangel an Frauen in Führungspositionen, führt dazu, dass sie weniger mit solchen assoziiert werden –und das Fehlen weiblicher Vorbilder, lässt viele junge Frauen an ihrer Eignung für diese Karrierewege zweifeln. Die Überpräsenz männlicher Führung erzeugt daher sowohl bei Männern, als auch bei Frauen den impliziten Bias, dass Männergenerell besser geeignet für die Chefetage sind. Der Stereotyp des “Doktors” als altehrwürdiger Arzt und Wissenschaftler im weißen Kittel ist in der Praxis noch immer weit verbreitet und gibt Männern einen Vertrauensvorschuss sowohl von Patient:innen, als auch auf Kolleg:innenseite (Xun et al. 2021). Fast jede junge Ärztin kennt die unangenehme Situation im Patient:innenzimmer ignoriert zu werden, während ein beistehender männlicher Medizinstudent als erfahrener Arzt wahrgenommen wird. Gleichsam werden Medizinstudentinnen regelhaft dem Pflegepersonal zugeordnet und erleben oft schon während des Studiums eine Benachteiligung aufgrund ihres Geschlechts.
Die gläserne Decke
Der Begriff der “gläsernen Decke”, der viele der in diesem Kapitel beschriebenen Faktoren zusammenfasst, beschreibt eine verborgene Barriere, die Frauen trotz gleicher Qualifikationen am Karriereaufstieg hindert. Diese Decke ist auf zwei Arten gläsern: sie ist unsichtbar, weil sie oft auf unbewussten Stereotypen basiert und gleichzeitig durchsichtig, da das Ziel zwar sichtbar, jedoch unerreichbar bleibt (Grover 2015).
Nicht nur Frauen kämpfen für Chancengleichheit und Repräsentation in den Führungsebenen des Gesundheitssystems. People of Color, LGBTQIA+-Personen oder Menschen mit Behinderung sieht man noch viel seltener in Spitzenpositionen. Besonders, wenn mehrere Diskriminierungsformen zusammenkommen, etwa bei einer Ärztin mit Kopftuch, sind Vorurteile und Barrieren besonders hoch. Diese Überlagerung und gegenseitige Verstärkung verschiedener Diskriminierungsformen wird als Intersektionalität bezeichnet. Das Konzept der Intersektionalität spiegelt die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft wider und kann uns als Sensibilisierungsinstrument für mehrdimensionale Diskriminierung dienen (Crenshaw 1989).
Sexuelle Belästigung
Weibliche Beschäftigte im Gesundheitssektor sind noch von einem weiteren Problem überproportional häufig betroffen: Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. In Deutschland ist die Studienlage hierzu sehr schlecht, die Problematik wird daher höchstwahrscheinlich stark unterschätzt, eine systematische Aufarbeitung erfolgt nicht. Internationale Daten zu Ärztinnen und Pflegerinnen zeigen aber, dass diese stark von sexueller Belästigung betroffen sind – oft mit weitreichenden Auswirkungen für ihre physische und mentale Gesundheit. (Kahsay et al 2020). In einem Arbeitsumfeld, in dem man diskriminiert und sexuell belästigt wird und sich nicht sicher fühlen kann, ist die freie und selbstbestimmte Karriereentwicklung stark beeinträchtigt. Umso wichtiger sind Präventionsmaßnahmen, Anlaufstellen für Betroffene sowie eine konsequente Aufarbeitung von entsprechenden Fällen (Ross et al. 2019).
2. Gleichstellung: Ein Gewinn für alle
Wird nun alles besser, wenn Frauen und Menschen mit Diskriminierungserfahrungen selbst in Führungspositionen vertreten sind? Ganz so einfach ist das natürlich nicht. Grundsätzlich sollte es allerdings schon aus einem Gerechtigkeitsanspruch selbstverständlich sein, dass alle Menschen, egal welches Geschlecht, welche körperlichen Voraussetzungen, welche sexuelle Orientierung oder welche Hautfarbe sie haben, die gleichen Chancen auf beruflichen Erfolg haben sollten. Dies muss auch in der Medizin gelten. Doch darüber hinaus ist die Einbeziehung verschiedener Perspektiven förderlich für das Gesundheitssystem, die Funktionalität von Teams und den Abbau von Diskriminierungen. Führungspersonen im Gesundheitswesen entscheiden zudem häufig über Behandlungs- oder Forschungsschwerpunkte an ihren Standorten. Themen der weiblichen Gesundheit sind in männlich dominierten Sphären oft unterrepräsentiert. Hier könnte mehr Diversität zu einer Verbesserung der Versorgung führen.
Die Art und Weise wie man ein Team führt und mit Kolleg:innen kommuniziert ist immer geprägt von den eigenen Erfahrungen und dem eigenen Hintergrund. So wird Frauen oft nachgesagt, sie seien als Führungskräfte empathischer, teamfähiger und würden einen stärkeren Fokus auf Kreativität legen (Verband Deutscher Unternehmerinnen 2016). Für die Medizin, bei der das Arbeiten in Teams ein zentrales Element darstellt, eigentlich eine gute Voraussetzung – dennoch setzen sich männliche Einzelkämpfer oft durch. Diese Zuschreibungen basieren oft auf Stereotypen und einem binären Geschlechtermodell, doch gewisse – gesellschaftlich anerzogene und sozialisierte – Unterschiede lassen sich sicher nicht abstreiten.
Auf die Führungsqualitäten von Frauen im Gesundheitssystem zu verzichten, ist nicht nur von Nachteil für die Frauen selbst, sondern für uns alle. Auch viele Männer fühlen sich mittlerweile von den hierarchischen Strukturen des Systems eingeengt und fordern flexiblere Arbeitsmodelle für eine bessere Work-Life-Balance.
Vom System frustrierte Frauen verlassen die Medizin und hinterlassen dabei Lücken, die oft schwer zu füllen sind. Vielversprechende Ärztinnen und Nachwuchswissenschaftlerinnen können ihr volles Potenzial aufgrund der bestehenden Barrieren nicht ausschöpfen. Bei durchschnittlichen Kosten von knapp 100.000 € pro Medizinstudienplatz kann sich unser Gesundheitssystem dies kaum leisten.
Die gläserne Decke beginnt zu splittern
Trotz der Chancen auf eine bessere Medizin, die sich durch mehr Frauen in Führungspositionen ergeben, ist es noch ein langer Weg bis zur Gleichstellung. Und der geht sich nicht von selbst. Wir alle können uns auf verschiedene Weise dafür einsetzen, dass Frauen und Männer gleichbehandelt werden – und am Ende alle profitieren.
Dafür müssen unter anderem die strukturellen Bedingungen in Kliniken und Wissenschaft verbessert werden:
Besser planbare Arbeitszeiten, flexiblere Arbeits-und Führungsmodelle, Schaffung von Betriebskindergärten und Anpassung der Kriterien für Beförderungen sind wichtige Schritte für Chancengleichheit – und bieten oft zusätzliche Vorteile. So etwa zeichnen sich Tandem-Führungskonzepte durch die Kombination verschiedener Expertisen und eine bessere interne Qualitätskontrolle Dank Vier-Augen-Prinzips aus. Durch einen diverseren und agileren Führungsstil können sie zu höherer Zufriedenheit im Team beitragen (Cogen u. Vaidyanathan2020, Krell 2021).
Bis es den entsprechenden Kulturwandel im Gesundheitswesen gibt, stellt eine Quote eine gute Übergangsmöglichkeit der Förderung dar. Kompetente Frauen, die bisher bei Beförderungen übergangen wurden, würden besser berücksichtigt und diverse Teams sichergestellt werden.
Gezieltes Mentoring für Frauen kann den Zugang zu beruflichen Netzwerken ermöglichen, welche für die Karriereentwicklung in der Medizinhäufig unabdingbar sind. In solchen Karrierenetzwerken besteht für junge Frauen die Möglichkeit weibliche Vorbilder zu finden. Denn junge Menschen suchen häufig nach Identifikationsfiguren, die ihnen ähnlich sind. Nur so können sie eine Vorstellung davon bekommen, welche Wege ihnen offenstehen.
Netzwerke erfüllen vielfältige Funktionen, so können sich von Diskriminierung Betroffene organisieren, austauschen und gegenseitig unterstützen. Aber auch diejenigen, die nicht betroffen sind, können auf individueller und struktureller Ebene ihre Privilegien nutzen, um die Situation zu verbessern.
Der Deutsche Ärztinnenbund e.V. setzt sich seit 1924 für bessere Rahmenbedingungen für Frauen in der Medizin sowie Forschung zu Gendermedizin ein. Damit sollen Frauen jeder Karrierestufe unterstützt und ihnen eine Zukunftsperspektive geboten werden. Es gibt aber auch zunehmend Mentoring Netzwerke für einzelne Fachrichtungen, die spezifische Austausch- und Förderangebote machen können.
Netzwerke erfüllen vielfältige Funktionen, so können sich von Diskriminierung Betroffene organisieren, austauschen und gegenseitig unterstützen.
Die Chirurginnen e.V.
Die Chirurginnen e.V.“Gemeinsam einfach besser” – nach diesem Motto hat sich im Januar 2021 der Verein Die Chirurginnen e.V. gegründet. Hauptziel des Vereins sind Vernetzung und gegenseitige Unterstützung von chirurgisch arbeitenden Frauen. Die Gründung des Vereins hat Wellen geschlagen, und im deutschsprachigen Gebiet bereits über 800 Frauen mit der gleichen Mentalität zueinander geführt.Der Effekt? Der Verein ist zu mehr als einem Netzwerk geworden – Unterstützung auf persönlicher Ebene - frei von Hierarchien, Vorbilderinnen/Mentoringprogramme für Studentinnen und junge Ärztinnen, Tipps von Erfahrenen zu Themen wie Niederlassung, Habilitation oder für den Schritt aus der Elternzeit zurück ins Berufsleben und vieles mehr. Die Chirurginnen zeigen, gezielte Förderung ist gefragt, und bringt Erfolge.Mehr Informationen zu aktuellen Aktivitäten unter https://chirurginnen.com
Doch die Verantwortung liegt nicht allein bei denen, die unter dem ungerechten System leiden. Stattdessen müssen Ansätze für Gleichberechtigung institutionell verankert werden. Auch Männer, insbesondere in Leitungspositionen, müssen ihren Teil zum Abbau der Ungerechtigkeiten beitragen. Chef:innen sollten anfangen sich zu fragen, wie und warum sie bestimmte Personen für die Beförderung auswählen. Bias-Training im Rahmen der Fortbildungen für Personal auf allen Ebenen könnte eine Möglichkeit sein, dieblinden Flecke offenzulegen und eine nachhaltige Verhaltensänderung zu bewirken. Das würde sowohl dem Gesundheitspersonal selber, als auch den Patient:innen zu Gute kommen.
Durch die Etablierung institutioneller Gleichstellungsbeauftragter lassen sich Anlaufstellen für Frauen schaffen, die sich sonst oft in diskriminierenden Situationen allein gelassen fühlen. Eine konsequente Aufarbeitung von Fällen, trägt zu einer sicheren und fördernden Arbeitsumgebung bei.
Ebenso müssen Elternzeit und Halbtagsmodelle für Väter institutionell normalisiert werden. Und um unfaire Gehaltsunterschiede zu vermeiden, sollten intransparente Verhandlungen unterbunden und die Bezahlung aller Mitarbeitenden stattdessen offengelegt werden.
Viele Einrichtungen des Gesundheitssystems verfolgen bereits einen oder mehrere dieser Ansätze und zunehmend sehen wir Frauen in Führungspositionen. Doch während sich die Befürchtungen des 26. Ärztetages nicht bewahrheitet haben, müssen wir auf die erste Präsidentin der Bundesärztekammer wohl noch weiter warten. Die gläserne Decke beginnt zu splittern – bis sie bricht, ist es allerdings noch ein langer Weg.
Und letztendlich geht es nicht nur um Frauen in der Führungsetage, sondern vielmehr um die Frage: Wie – und mit wem – wollen wir im Gesundheitswesen in Zukunft (zusammen)arbeiten?
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch "Toolbook Ärztin:Arzt" herausgegeben von Jana Luisa Aulenkamp und Dr. med. Thomas Hopfe. Alle Informationen zum Titel erhalten Sie hier.

 Health Care Management
Health Care Management