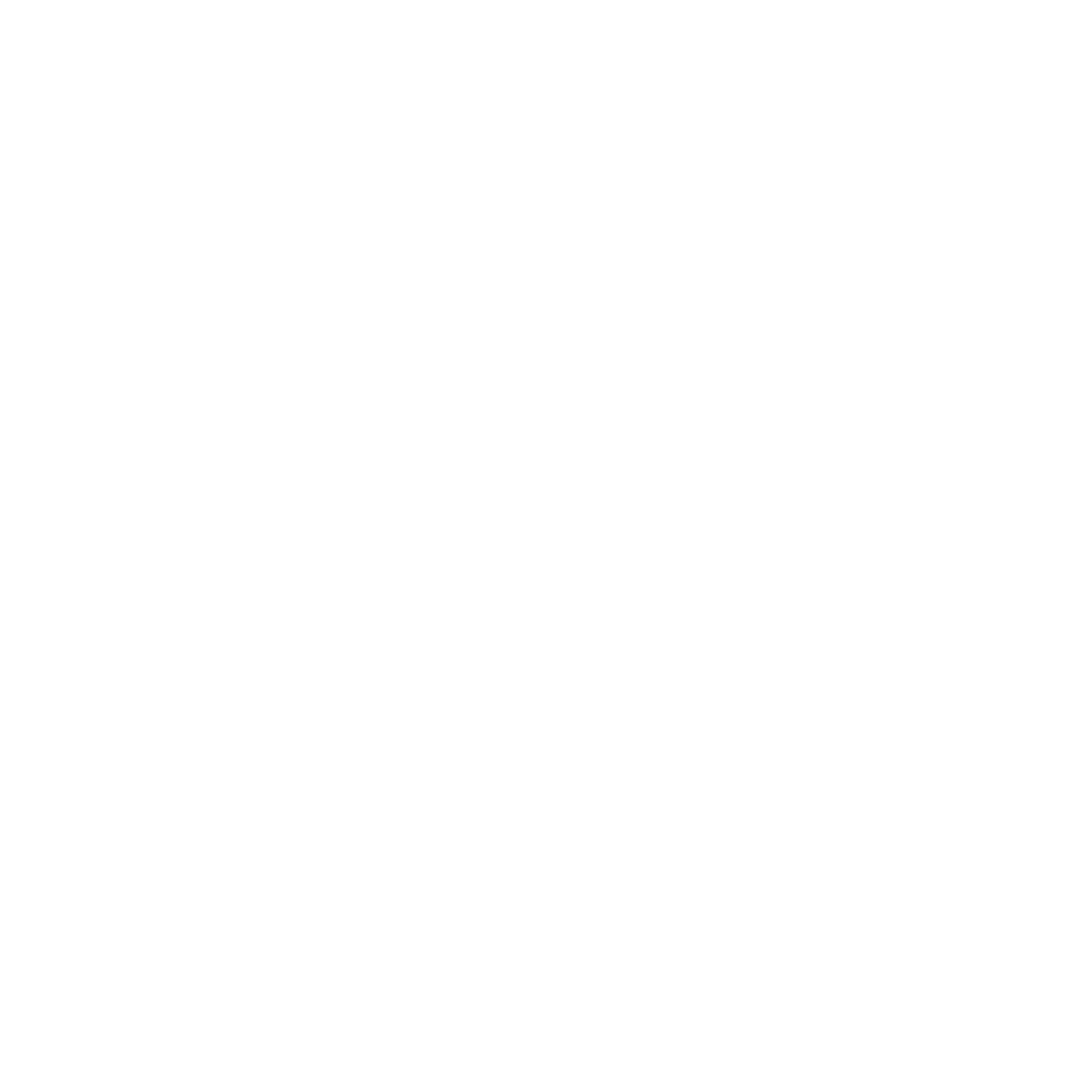Interview mit Jörg Debatin
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat im April 2019 den health innovation hub (hih) gegründet. Zwölf Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen unterstützen die Regierung darin, die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzubringen. Sie beschäftigen sich mit zukunftsweisenden digitalen Technologien und verdrahten Start-ups, Akteure und Entscheider mit der Politik. So sollen innovative Ideen schneller in die Praxis kommen. Ein Gespräch mit dem Leiter des hih, Prof. Dr. Jörg Debatin, über die Chancen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft für die Gesundheitsversorgung. Das Interview führte Silvia Wirth.
Der hih soll eine Ideenfabrik für digitale Gesundheitslösungen sein. Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, Tempo in die digitale Transformation des deutschenGesundheitssystems zu bringen. Eine große Aufgabe mit vielen Baustellen. Wo fangen Sie an?
In unserer Rolle als Think-Tank für das BMG bringen wir Ideen ein mit dem Ziel, die digitale Agenda für das deutsche Gesundheitswesen weiter zu entwickeln. Es geht darum, auszuloten, wie die Versorgung der Menschen in Deutschland mit digitalen Projekten verbessert werden kann. Dafür suchen wir sowohl national als auch international nach neuen Impulsen. Wir schauen uns an, was andere machen und ob diese Ideen auch in Deutschland umsetzbar sind. Ein Thema, das uns derzeit besonders beschäftigt, ist die elektronische Patientenakte (ePA). Damit sie zum 1. Januar 2021 starten kann gilt es, die kritischen Inhalte zu definieren und die nötige Vernetzung sowie den Austausch unter allen beteiligten Akteuren zu schaffen. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit besteht darin, Wege zu finden, wie wir in Deutschland Daten sowohl für die medizinische Wissenschaft als auch für die bessere Versorgung von Patienten verfügbar machen können.
Um die digitale Transformation zu beschleunigen, soll der hih die Brücke schlagen zwischen den klassischen Stakeholdern im Gesundheitswesen und den neuen Playern, der Start-up-Szene. Wie funktioniert dieser Brückenschlag?
Der hih wirkt als Katalysator zwischen den verschiedenen Beteiligten. Es geht nicht nur darum, den Austausch zwischen Start-ups und klassischen Playern wie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung oder etwa Krankenkassen zu fördern, sondern auch darum, das gegenseitige Verständnis und Verstehen zu erhöhen. Kommunikation hilft an vielen Stellen, systemische Probleme zu lösen. Wir vernetzen Start-ups mit der Versorgungsrealität, die in Praxen und Krankenhäusern herrscht. Gleichzeitig geben wir kontinuierliches Feedback ans BMG über noch bestehende Defizite und wo es konkret noch hakt.
Der hih nimmt eine besondere Position im gesundheitspolitischen Institutionengefüge ein. Der Hub ist für drei Jahre gegründet, hat keine direkte Entscheidungskompetenz. Sie sollen beraten und vernetzen und so den Nukleus für die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens bilden. Was ermöglicht Ihnen diese besondere Stellung, was andere Institutionen nicht können?
In der Tat sind wir recht frei in unserem Denken und Handeln. Ich empfinde das als riesiges Privileg. Gleichzeitig verstehen wir diese Freiheit als großen Vertrauensvorschuss des Bundesgesundheitsministeriums. Das spornt uns noch mehr an, unseren Beitrag zu leisten und jenseits der bestehenden, eher ritualisierten und damit wenig zielführenden Austauschformate bestehende Probleme direkt anzusprechen und Lösungen gemeinsam zu entwickeln. Aufgrund unserer Verankerung in der Welt der Leistungserbringer erfahren wir ein wohlmeinendes Entgegenkommen und eine hohe Akzeptanz – allerdings auch einhergehend mit Erwartungen. Gleichzeitig haben wir das Vertrauen des Ministeriums, das uns drei Jahre finanziert, damit wir helfen können, die digitale Transformation des Gesundheitswesens zu gestalten. Diese Doppelrolle funktioniert erstaunlich gut und auch besser als zumindest von mir erwartet. Ich bin wirklich positiv überrascht, wie offen man uns gegenüber ist. Wir können uns nicht beklagen über einen Mangel an Akzeptanz oder Wahrnehmung. Die Konzeption des hih ist und bleibt ein Experiment. Bislang bin ich mit dem Resultat ausgesprochen zufrieden – unsere Ideen und Beiträge werden von allen Seiten angehört und angenommen.
Was ist besser gelaufen als erhofft?
Richtig gut gelaufen ist die Zusammenstellung des hih-Teams. Das hatte ich mir deutlich schwerer vorgestellt, zumal wir ja ein eingebautes Verfallsdatum Ende 2021 haben. Dennoch ist es gelungen ein Team zusammenzustellen, das sich durch profunde Expertise in allen für die Digitalisierung relevanten Aspekten auszeichnet. Die Gruppe setzt sich aus medizinischen Leistungserbringern wie Ärzten und Apothekern, Juristen, Politikwissenschaftlern und Betriebswirten zusammen. Wir verfügen im hih über eine zumindest in Deutschland einmalige interdisziplinäre Mischung aus medizinischem Know-how, umfassender Datenexpertise – von Interoperabilität bis hin zu Big Data und KI-Applikationen, juristischem Wissen in den Bereichen Datenschutz und Medizinprodukterecht sowie persönlicher Erfahrung im Aufbau von Start-ups im deutschen Gesundheitswesen. In und mit diesem Team zu arbeiten, empfinde ich als großes Privileg.
Sie sind inzwischen seit mehr als einem Jahr im Amt. Wie lautet Ihr Resümee wenn Sie auf die Zeit zurückblicken: Was ist bereits geschafft, welche Aufgaben liegen noch vor Ihnen?
Der Erfolg des hih muss sich daran messen lassen, ob es gelingt, digitale Innovationen zu den Patienten zu bringen. Das ist unser Ziel – aber daran arbeiten wir natürlich nicht allein. Ein erster Schritt auf diesem Weg sind die „Gesundheits-Apps auf Rezept“, die in Deutschland ab Sommer verfügbar sein werden. Hier wird sich zeigen, ob es gelingt, digitale Produkte sowohl im Praxisalltag von Ärzten zu verankern als auch die notwendige Akzeptanz bei Patienten zu schaffen.
Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im Bereich Gesundheit und Pflege wird sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Daten beschäftigen. Sie haben einmal über Ihre Aufgabe im hih gesagt „Wir werden drängeln, wo wir es für nötig halten“. Wo halten Sie beim Blick auf Europa „drängeln für notwendig“?
Besonders bei der Frage, wie wir mit relevanten Gesundheitsdaten umgehen. Hier brauchen wir ein Modell, das sich erkennbar von dem staatlichen Datenmonopol der Chinesen, aber auch von dem Markt-dominierten Ansatz der Amerikaner abhebt. Europa hat andere, eigene Werte zu den Themen Selbstbestimmung und Dateneigentum. Europa muss somit einen eigenen Weg für den Umgang mit Daten finden. Für uns Europäer ist selbstverständlich: Medizinische Daten gehören ganz ausschließlich dem Individuum. Es ist allerdings wichtig, dass dann für den Einzelnen die Möglichkeit besteht die eigenen medizinischen Daten in anonymisierter Form der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Für den Fortschritt in der Medizin und der Versorgung ist die Verfügbarkeit von kuratierten, hochwertigen Daten geradezu zwingend. Beispielsweise mussten wir bei der Konzeption der sogenannten Proximity TracingApp, im Kampf gegen die Corona-Pandemie feststellen, wie abhängig wir von Google und Apple sind. Für die Zukunft müssen wir uns Gedanken darüber machen, dass es in Europa kein Unternehmen gibt, das hier auf Augenhöhe agiert. Dieses Defizit muss in einer Post-Corona-Zeit diskutiert und angegangen werden.
Natürlich ist Datenschutz ein hohes Gut. Als gemeinsamen Nenner haben wir in der EU die DSGVO. Wir sehen jedoch, dass sie bezüglich der Freigabe medizinischer Daten für die Wissenschaft in den einzelnen Mitgliedsländern sehr unterschiedlich interpretiert wird. Um international wirklich mitzumischen, benötigen wir EU-weite, einheitliche Regeln und Strukturen, die zum einen Rechtssicherheit schaffen und zum anderen dazu beitragen, dass eine qualifizierte Datensammlung für Wissenschaft und Forschung zur Verfügung steht. Der Umgang der Mitgliedsländer mit diesem Thema ist sehr unterschiedlich. In Finnland sind die Menschen beispielsweise verpflichtet, ihre Daten für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens zur Verfügung zu stellen – ohne explizite Zustimmung. Das wäre in Deutschland nicht durchsetzbar und das ist auch gut so. Hier brauchen wir einen Kompromiss. Die Zukunft der medizinischen Wissenschaft wird auf der Analyse riesiger Datenansammlungen beruhen (Big Data).
Bislang gibt es kein europäisches Verständnis zum Umgang mit Forschungsdaten. Der individuelle Anspruch auf den Schutz persönlicher Daten muss abgewogen werden mit dem kollektiven Interesse Krankheiten durch eine gesicherte Datenlage besser erforschen zu können. Wie sollte eine europäische Datenethik aussehen?
Wir sollten die EU-Präsidentschaft nutzen, um bei diesem Thema auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und in Zukunft konzertiert handeln zu können. Jedes Land allein wird nicht genug Daten produzieren, um die inhaltlichen Herausforderungen in der Weiterentwicklung der Medizin bedienen zu können. Es muss nicht nur einen Diskurs darüber geben, ob und welche Daten verwendet werden dürfen, sondern auch, wie man mit KI-Applikationen regulatorisch umgeht. Hier sollten wir Synergien nutzen. Denn das sind Fragestellungen, die jedes europäische Land beantworten muss. Wenn wir hier eine gemeinsame Linie finden, ebnet das nicht nur den Weg für eine bessere Vernetzung, sondern wir arbeiten auch effizienter.
Schottet sich Europa mit strengem Datenschutz von technologischen Möglichkeiten ab oder kann im Gegenteil ein strenger Datenschutz sogar ein Wettbewerbsvorteil sein?
Es kann tatsächlich beides sein. Die DSGVO ist zunächst einmal Ausdruck eines Wertegefüges, das uns als Europa definiert. Langfristig sehe ich das als Wettbewerbsvorteil, da ich glaube, dass auch die Menschen in anderen Ländern über kurz oder lang ähnliche Wertevorstellungen entwickeln werden. In den Vereinigten Staaten stößt der marktorientierte Umgang mit Daten bereits heute auf zunehmende Gegenwehr. Gleichzeitig sind die Grenzen eines rein staatlich reglementierten Umgangs mit Daten in China nicht zuletzt durch die COVID-19-Epidemie für alle sichtbar geworden. Die Digitalisierung sollte dazu genutzt werden, die Werte, die wir für uns in Europa als wichtig erachten, zu sichern. Genau hier sehe ich derzeit noch ein Vakuum, das innerhalb der EU möglichst rasch gefüllt werden sollte.
Bislang fehlt eine eindeutige europäische Idee für einen selbstbestimmten Umgang mit Daten. Wir wissen nur, dass wir weder das amerikanische noch das chinesische System wollen. Wie könnte Ihrer Meinung nach, ein Dritter, ein europäischer Weg gelingen, der die Balance zwischen Markt und Staat wahrt?
Die Basis für einen europäischen Weg ist eine Infrastruktur, die es uns ermöglicht, unsere Werte auch in die Praxis umzusetzen. Was nutzen uns europäische Regelungen, wenn wir keine Datenspeichersysteme haben, für die wir sie anwenden können? Wir brauchen dringend ein europäisches Cloud-Infrastruktur-Unternehmen, damit wir nicht mehr auf ausländische Anbieter wie Amazon (AWS), Microsoft (Azure) oder Tencent angewiesen sind. Das ist eine grundsätzliche Infrastruktur-Diskussion, die alle Tech-Branchen betrifft. Ich wäre dafür, dass wir in Europa beim Thema Cloud- und Dateninfrastruktur den gleichen Weg gehen, wie die Luftfahrtbranche in den 70er-Jahren.
Sie sprechen die Gründung von Airbus vor 50 Jahren an. Airbus wurde gegründet als Zusammenschluss deutscher und französischer Flugzeugbauer. Das Ziel der neuen Gesellschaft war es, den damaligen Marktführern – den amerikanischen Herstellern Boeing und McDonnell Douglas – konkurrenzfähige Passagierflugzeuge entgegen zusetzen. Was braucht es für ein europäisches Cloud-Unternehmen nach Ihren Vorstellungen?
Für Europa war es damals wichtig, in einer Schlüsseltechnologie ebenfalls eine Rolle zu spielen. Aber weder Deutschland noch Frankreich allein hatten die notwendige Größe und Finanzkraft oder das Know-how, um so ein Vorhaben zu stemmen. In Sachen digitaler Infrastruktur sieht es heute leider ähnlich aus: Wir brauchen ein schlagkräftiges europäisches Cloud-Unternehmen nach dem Vorbild von Airbus mit der klaren Erwartungshaltung, während der Aufbauphase in den ersten zehn Jahren keinen Gewinn zu erzielen. Nur bei einem europäischen Datenunternehmen in staatlicher(EU)-Trägerschaft, können wir sicher sein, dass sich die Governance an den europäischen Werten orientiert. Ein solches Unternehmen ist für den wirtschaftlichen Fortschritt in Europa unabdingbar. Nicht nur die Gesundheitsbranche ist für die weitere Entwicklung auf Daten angewiesen – alle anderen Wirtschaftszweige ebenfalls. Nur mit dem Aufbau eines solchen Unternehmens wird sich Europa auch in Zukunft erfolgreich von den USA als auch von China emanzipieren können.
Beim Digitalgipfel im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung das Projekt Gaia X vorgestellt. Ein offenes, digitales Ökosystem, in dem Daten europaweit sicher zusammengeführt und geteilt werden können sollen. Allerdings soll der Datenraum ausdrücklich keine Konkurrenz zu großen amerikanischen Anbietern wie Google, Microsoft oder Amazon sein. Unterstützen Sie die Idee?
Gaia X startet als „Projekt“, das ist zu wenig. Wenn wir in Europa wettbewerbsfähig bleiben wollen, brauchen wir ein richtiges Unternehmen, das in der Eigentümerstruktur europäisch gebrandet ist – so wie das damals bei Airbus auch der Fall war. Es muss ein Unternehmen mit langfristigem Gewinnstreben sein, das eine eigene Infrastruktur bereithält. Diese Kriterien erfüllt Gaia X nicht. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber die Wahrung der digitalen Unabhängigkeit Europas sehe ich dadurch nicht gesichert. Bereits jetzt haben sich die amerikanischen Tech-Giganten bei Gaia X breit gemacht.
Wir sehen jetzt bereits, wie schwierig es ist, allein in Deutschland ein gemeinsames Verständnis zwischen unterschiedlichen Akteuren zu schaffen, um ein großes Digitalprojekt wie die ePA auf die Beine zu stellen. Diese Friktionen werden sich potenzieren, wenn die Akteure und unterschiedlichen Interessengruppen von 27 Ländern harmonisiert werden müssen. Wie hoch ist die Realisierungswahrscheinlichkeit einer europäischen Cloud?
Ich stelle eine Gegenfrage: Was ist die Alternative? Es gibt niemals eine Erfolgsgarantie für solche ambitionierten Vorhaben. Die Alternative ist, dass wir uns abkoppeln von Innovationen, keine eigenen Entwicklungen mehr wagen und in eine Situation geraten, in der unsere Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist. Wir versuchen zunehmend, uns wieder über Europa zu definieren. Dazu gehört die Diskussion darüber, nach welchen gemeinsamen Regeln wir Daten organisieren. Wir haben so viele europäische DIN-Normen, die ebenfalls das Ergebnis von intensivem Austausch sehr vieler unterschiedlicher Akteure sind. Entsprechend halte ich ein europäisches Cloud-Unternehmen für realisierbar.
Glauben Sie, dass Europa so einen Zusammenschluss noch rechtzeitig realisieren kann? Im Wettstreit um die globale Technologievorherrschaft im Gesundheitsbereich sind amerikanische Konzerne schon weit. Google greift mit Projekten wie Nightingale bereits tief in die amerikanische Versorgungsstruktur ein und generiert Daten.
Ich bin Grundoptimist und sehe die Chancen für ein europäisches Konkurrenzunternehmen zu den großen Tech-Playern der USA oder China gar nicht negativ. Als wichtigste Voraussetzung für den Erfolg brauchen wir smarte Leute. Als ich für GeneralElectric Healthcare gearbeitet habe, waren wir sehr oft im Silicon Valley. Ich war damals erstaunt, bei wie vielen jungen, innovativen Start-ups Deutsch, Spanisch oder Französisch gesprochen wurde. Ich glaube, einen Mangel an guten Leuten mit Ideen und Know-how haben wir weder in Deutschland noch in Europa. Die Frage ist, ob die nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen, um wirklich konkurrenzfähig zu werden. Die Bedenken hätte man damals auch bei der Gründung von Airbus anbringen können. Heute erkennen wir, dass sich der Mut, Airbus zu gründen, ausgezahlt hat. Ich glaube, dass der Unterschied zwischen Boeing und Airbus gerade in jüngster Zeit auch in der Kultur sichtbar wird: Die europäische Kultur des Unternehmens ist meiner Meinung nach ein grundlegender Faktor für den Erfolg. Damals war es wichtig, in eine Schlüsseltechnologie zu investieren. Und heute ist es zwingend richtig, in einen Cloud-Provider zu investieren, um nicht abhängig zu bleiben.
Im Rahmen des Digitale-Versorgung-Gesetzes haben wir gesehen, dass die Nutzung von Daten – insbesondere Patientendaten – in der Bevölkerung ein viel diskutiertes Thema war und ist. Wie können wir in Europa ein gemeinsames Datenschutzverständnis aufbauen?
Die Diskussion in den Medien steht in krassem Gegensatz zu repräsentativen Befragungen .97 Prozent der Menschen sagen, dass sie gern bereit sind, ihre medizinischen Daten der Wissenschaft zu spenden. Die mediale Präsenz, die die drei Prozent der Verweigerer haben, scheint doch etwas überakzentuiert. Wir müssen den 97 Prozentder Bevölkerung eine stärkere Stimme geben. Mir ist es wichtig, dass wir respektieren, wenn Menschen ihre Gesundheitsdaten der Forschung nicht zur Verfügung stellen möchten. Unabhängig vom Zweck, sollte niemand gezwungen werden, seine Daten, auch in anonymisierter Form herauszugeben. Auf der anderen Seite müssen wir sicherstellen, dass die Daten der Mehrheit – der 97 Prozent, die einverstanden sind – auch für Forschung und Entwicklung genutzt werden. Wir dürfen uns nicht in eine Negativ-Debatte verrennen, die den Willen der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung nicht spiegelt. Ich glaube nicht, dass das Grundverständnis von Datenschutz in Deutschland sich fundamental von anderen EU-Ländern unterscheidet. Unser Umgang mit diesem Thema in der öffentlichen Debatte ist jedoch ein anderer. Und offenbar müssen wir – und hier adressiere ich alle, die sich mit der Gesundheitsversorgung in Deutschland beschäftigen – bessere Aufklärungsarbeit leisten und den Nutzen von Forschungsdaten stärker in den Vordergrund stellen, benennen und wahrnehmbarer vertreten.
Bei dem Konzept Datensouveränität geht es immer auch darum, dass der einzelne Bürger die Kontrolle über seine Daten behält. Angesichts der Datenmengen, die inzwischen von verschiedensten Unternehmen/Institutionen erhoben, analysiert, verknüpft werden, ist es naiv anzunehmen, dass das funktionieren kann. Brauchen Patienten mehr Macht über ihre Daten? Wie realistisch ist es, dass Bürger bei komplexen Datenschutzeinstellungen und unzähligen Optionen zum Berechtigungsmanagement – etwa bei der ePA – den Überblick behalten?
Ich glaube, dass es richtig ist, wenn bei jeder Anwendung die Möglichkeit besteht, feingranular zu bestimmen, was mit den eigenen Daten geschieht, damit jeder seinen Individualwunsch abbilden kann. In der Realität werden wir feststellen, dass 99 Prozent der Nutzer das gar nicht wollen. Für diejenigen, die es anders wollen, muss es die Möglichkeit geben, im Detail festzulegen, welche Daten von wem zu welchem Zeitpunkt eingesehen werden können. Das entspricht unserem europäischen Wertegefüge. Wichtig ist nur, dass es für die breite Masse, die sich nicht tiefgehend mit dem Berechtigungsmanagement ihrer medizinischen Daten beschäftigen möchte, eine einfache Möglichkeit gibt, alle Daten für alle Behandler freizugeben.
Dieses Interview ist ein Auszug aus dem Buch Digitale Gesundheit in Europa – herausgegeben von Dr. Jens Baas.

 Health Care Management
Health Care Management