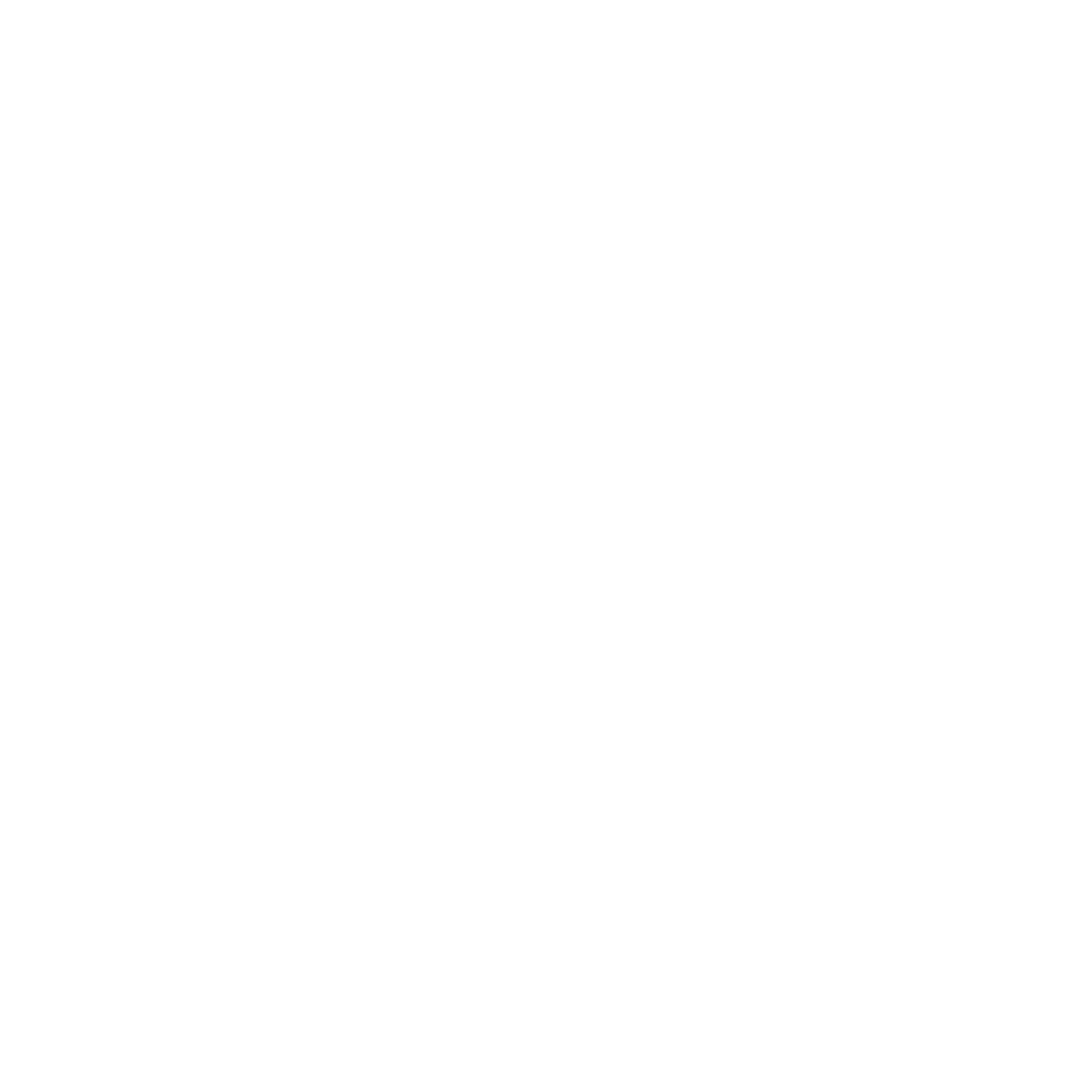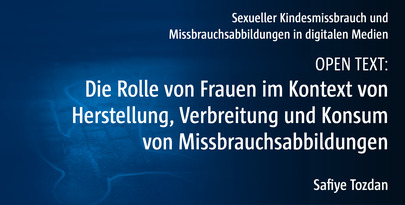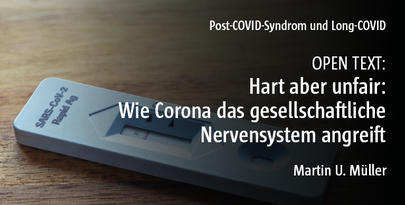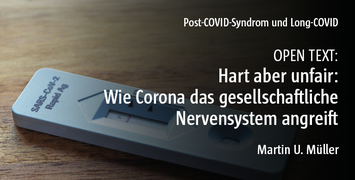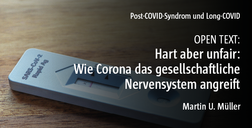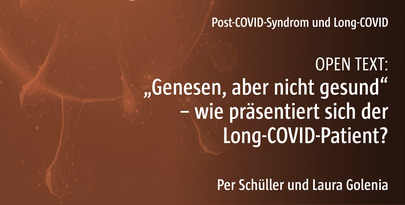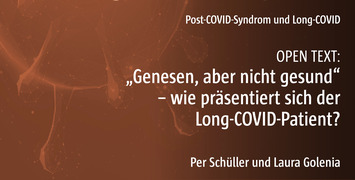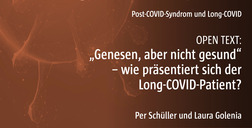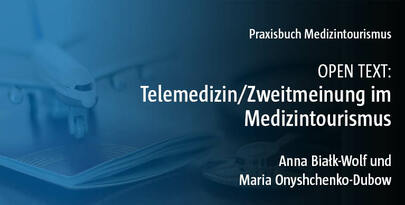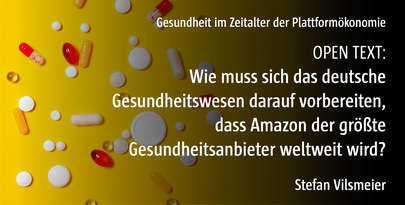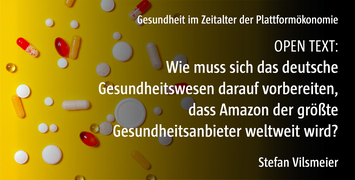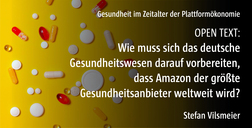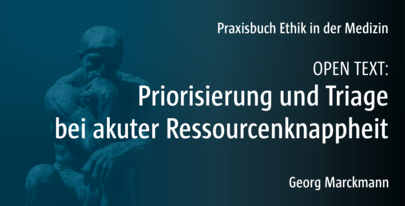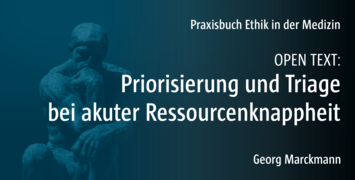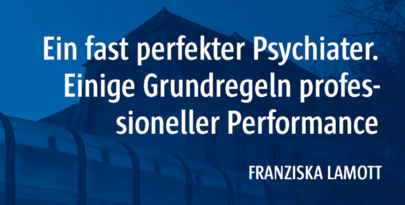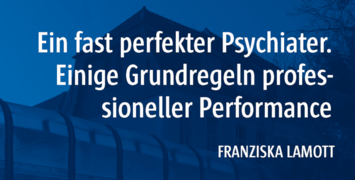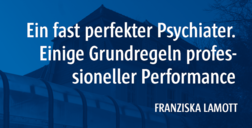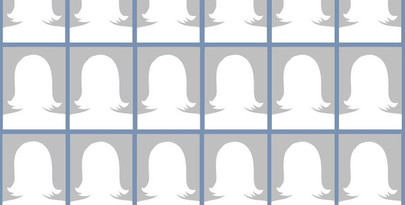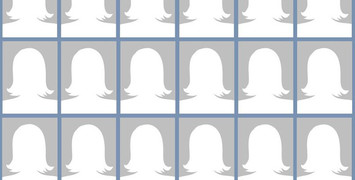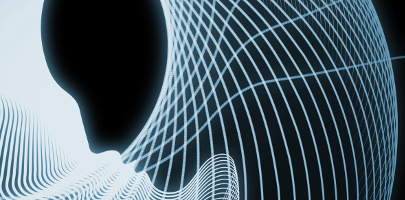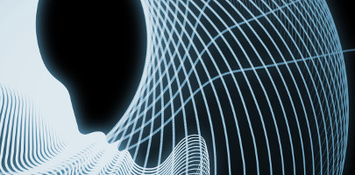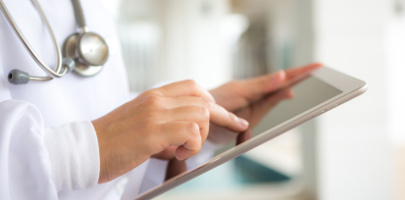Psychotherapie: Risiken und Nebenwirkungen
Empfehlungen für die Aufklärung von Risiken und Nebenwirkungen in der Psychotherapie
PHILIPP HERZOG UND MICHAEL LINDEN
Wie bereits angesprochen, gilt für die Aufklärung in der Psychotherapie, dass sie ein Prozess ist und nicht eine einmalige Offenlegung von Informationen, wie dies für einmalige und begrenzte Interventionen gilt, wie z.B. vor einer Operation (Blease et al. 2016). Ein klassischer „Beipackzettel“ wie bei Medikamenten ist aufgrund der prozeduralen Natur einer Psychotherapie nicht zielführend und nicht geeignet, um über Nebenwirkungen vor und während einer Psychotherapie aufzuklären. Allerdings bedeutet das nicht, dass auf eine Aufklärung verzichtet werden kann (Barnett et al. 2007).
Patienten sollten im Rahmen der Aufklärung nicht nur offen und kompetent über die geplante Behandlung, die Behandlungsrationale und die erwartete Prognose der Psychotherapie informiert werden, sondern sie sollten auch während des gesamten Prozesses der psychotherapeutischen Behandlung aktiv in den Entscheidungsprozess einbezogen werden (Gerger et al. 2020, Goddard et al. 2008).
Im Rahmen einer Langzeitpsychotherapie sollten zu Beginn folgende Bereiche angesprochen werden (erweitert nach Wenning 1993):
- theoretisches Diagnosemodell
- Behandlungsempfehlung
- potenzielle Risiken
- erwartbarer Nutzen der Behandlung
- Verfügbarkeit von weniger kostspieligenKurzzeitinterventionen
- Klärung der Notwendigkeit einer Psychotherapie
- Grenzen der Kostenübernahme durch die Versicherung
- Pläne zur Messung der Reaktion des Patienten aufdie Behandlung (z.B. psychometrisches Feedback)
- Verständnis von Psychotherapie als individuelleErfahrung und informierte Einwilligung als komplexer Prozess
- Abklärung der Erwartungen von Therapeut undPatient
- potenzielle finanzielle und rechtliche Nachteile(z.B. Verbeamtung, Abschluss von Versicherungen)
- Stigmatisierung
Konkreter können Aufklärungen bei umschriebenen Therapieinterventionen vorgenommen werden (z.B. Angst vor einer Expositionsübung, Probleme mit dem Partner bei Assertiveness-Übungen). Welche Informationen im Einzelnen jedoch für die Einholung einer informierten Einwilligung erforderlich sind, ist wissenschaftlich nicht abschließend beantwortet, insbesondere in Bezug zur Rolle von allgemeinen therapeutischen Faktoren (Blease 2020; Leder 2020, 2021).
Die Aufklärung von Patienten in der Psychotherapie sollte als aktiver und kontinuierlich ablaufender Prozess unabhängig jeglicher therapeutischer Orientierungen als Zeichen einer evidenzbasierten Praxis verstanden werden, um die Autonomie des Patienten zu respektieren (Gerger et al. 2020). Leitlinie muss sein, dem Patienten die Informationen zu geben, die für seine selbstbestimmte Einwilligung in die Psychotherapie erforderlich sind (Linden u. Helmchen 2018). Dies beinhaltet keine Aufklärung über technische Details oder psychologische Wirkprinzipien. Es ist fortlaufend aufzuklären über
- die unmittelbaren Ziele der aktuellen therapeutischen Interventionen,
- potenziell belastende und natürlich schwerwiegende Risiken,
- Risiken, die dem Patienten bewusst sein sollten, um sie gegebenenfalls verhindern zu können (beispielsweise, dass man nicht die Arbeitsstelle kündigt, wenn in der Therapie Arbeitsprobleme angesprochen werden),
- Nebenwirkungen, die der Patient tolerieren sollte, um den Therapieprozess nicht zu gefährden (z.B. kurzfristiger Angstanstieg bei Exposition).
Für eine derartige interventionsspezifische Aufklärung ist es erforderlich, das Nebenwirkungsprofil der jeweils konkret zur Anwendung kommenden Interventionen zu kennen. Diese können sehr unterschiedlich sein, abhängig davon, ob eine Expositionsbehandlung, ein sokratischer Dialog oder ein soziales Kompetenztraining oder Regression ansteht.
Bei der Aufklärung von Patienten kommt es nicht nur auf den Inhalt, sondern ebenso auf die Form an. Es ist darauf zu achten, dass der Patient die für ihn entscheidungsrelevanten Informationen auch versteht und nicht gezwungen werden darf (Cocanour 2017). Das Patientenrechtegesetz verlangt, dass eine Aufklärung patientenadaptiert sein muss, was etwas Anderes ist, als den Patienten mit mehrseitigen und möglichst umfassenden Aufklärungsformularen (z.B. im Sinne eines „Beipackzettels“) zu überfordern. Aufklärung kann daher als eine eigenständige psychotherapeutische Fähigkeit angesehen werden (Goddard et al. 2008). Es klingt zwar banal, ist aber nicht selbstverständlich, dass der Therapeut für den individuellen Patienten im richtigen Moment die richtigen Worte finden sollte.
Wirksamkeit und Nebenwirkungen können als zwei Seiten einer Medaille besprochen werden (Helmchen u. Linden 2020). Die Information über Risiken sollte mit der Mitteilung über Bewältigungsmöglichkeiten kombiniert werden. So könnte dem Patienten die Behandlung als eine Reise in ein teilweise unbekanntes Gebiet vorgestellt werden, die nicht nur zu (als Therapieziel angestrebten) neuartigen Erfahrungen führen soll, sondern auf der ihm auch (zu benennende) Gefahren begegnen können. Der Antagonismus zwischen der Pflicht zur Aufklärung und der zur Vermeidung von Schäden durch Aufklärung über Risiken könnte durch solche Betonung wechselseitiger Komplementarität entschärft werden (Helmchen 2017). Dies könnte letztlich zum Aufbau von realistischen Therapieerwartungen führen. Denkbar ist auch, der Aufklärung am Beginn der Psychotherapie eine Phase vorzuschalten, in der vor allem die Krankheitseinsicht und die therapeutische Beziehung im Sinne des Arbeitsbündnisses gefördert werden (Heigl-Evers u. Heigl 1989).
Es kann seitens des Therapeuten eine Zurückhaltung geben, Patienten zu informieren und Nebenwirkungen zu besprechen, weil befürchtet wird, dass dies ein Eingeständnis ist, dass in der Behandlung etwas schiefgelaufen ist, dass der Therapeut schuld sein muss und dass dies die Bereitschaft des Patienten zur Kooperation in der Therapie behindern kann (Eaton et al. 1993; Flückiger et al. 2018; Frohburg 2002; Fuertes et al. 2017; Märtens 2018; Märtens u. Petzold 2002). Ebenso können Patienten Schwierigkeiten haben, über Nebenwirkungen zu sprechen oder zu berichten, da sie befürchten, dass dies die Beziehung zum Therapeuten beeinträchtigen könnte, da es wie eine Kritik klingen könnte. Um solche Missverständnisse zu überwinden, könnte sich anbieten, dass eine Kombination aus schriftlicher und mündlicher Offenlegung von Informationen den Patienten vor der Behandlung zur Verfügung gestellt wird, aber dass die Offenlegung zusätzlich ein fortlaufender, aktiver Informationsaustausch sein sollte, während die Therapie stattfindet (Barnett et al. 2007). Diese schriftlichen Informationen sollten aber anders als die auf einem „Beipackzettel“ für Medikamente im Rahmen der Pharmakotherapie gestaltet sein und generelle Informationen zur Psychotherapie beinhalten, wobei Nebenwirkungen nur einen Unterpunkt darstellen sollten. Insgesamt sollten diese Vorabinformationen auch eher in den ersten psychotherapeutischen Prozess – und zwar der Psychoedukation –eingebettet sein und Teil der Sicherung der therapeutischen Beziehung („Arbeitsbündnis“) sein (Wettig 2006). So sollte die Pflicht zur Aufklärung als vertrauensbildende Intervention gestaltet werden, in der sich der Patient aufgeklärt fühlt und aktive Teilnahme erleben kann (Stacey et al. 2017). Es gibt also gute Gründe zu der Annahme, dass es in der Psychotherapie durchaus regelhaft und umfänglich eine Behandlungsaufklärung gibt, die aber oft bisher unter anderen Termini gefasst wird.
Ein wichtiger Weg, um Nebenwirkungen zu erkennen, ist das professionelle Wissen über die therapeutischen Prozesse von Interventionen im Zusammenspiel mit den individuellen Charakteristika der Patienten, die Probleme verursachen können. Dem Therapeuten sollten Risiken und Nebenwirkungen seiner Interventionen bewusst sein, um den Patienten informieren zu können. Dies kann helfen, aufkommende Probleme zu verhindern oder zu erkennen und zu managen.
Die Verwendung von standardisierten Instrumenten kann dabei helfen, negative therapeutische Effekte zu überwachen, da sie die Aufmerksamkeit auf kritische Bereiche lenken (Herzog et al. 2019). Nebenwirkungen treten in verschiedenen Lebensbereichen auf, sodass in der Probatorik und biografischen Anamnese beruflicheund private Kontextfaktoren erfasst werden müssen, zur Abschätzung von sozialmedizinischen Problemmöglichkeiten (z.B. finanziellen Absicherung bis hin zu Verlust von Ansprüchen in den Sozialkassen oder nachträgliche Aufhebung von Krankschreibungen durch den MDK) (s. Kap. I.4).
Aus der Compliance-Forschung in der Pharmakotherapie lässt sich lernen, dass das Erkennen, Verstehen und Ansprechen von Überzeugungen und Ängsten der Patienten eine Form der Empathie ist, Vertrauen schafft und die Kooperation des Patienten verbessern kann (Brown et al. 2016). In diesem Sinne kann das Sprechen über mögliche Nebenwirkungen ein Signal für den Patienten sein, dass der Therapeut professionell und kompetent agiert, dass er mögliche Belastungen für den Patienten sehenden Auges hinnimmt, weil er die Behandlung als notwendig erachtet, dass er sich andererseits aber auch um den Patienten kümmert und Empathie für sein Leiden hat und schließlich dem Patienten auf Augenhöhe entgegentritt, da er solche schwierigen Anliegen mit ihm bespricht. Der Patient kann von negativen Erfahrungen und Erlebnissen berichten, ohne Angst haben zu müssen, den Therapeuten zu kritisieren, da das Thema bereits angesprochen ist.
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch "Erfassung von Psychotherapie-Nebenwirkungen" herausgegeben von Michael Linden und Bernhard Strauß . Alle Informationen zum Titel finden sie hier.

 Health Care Management
Health Care Management