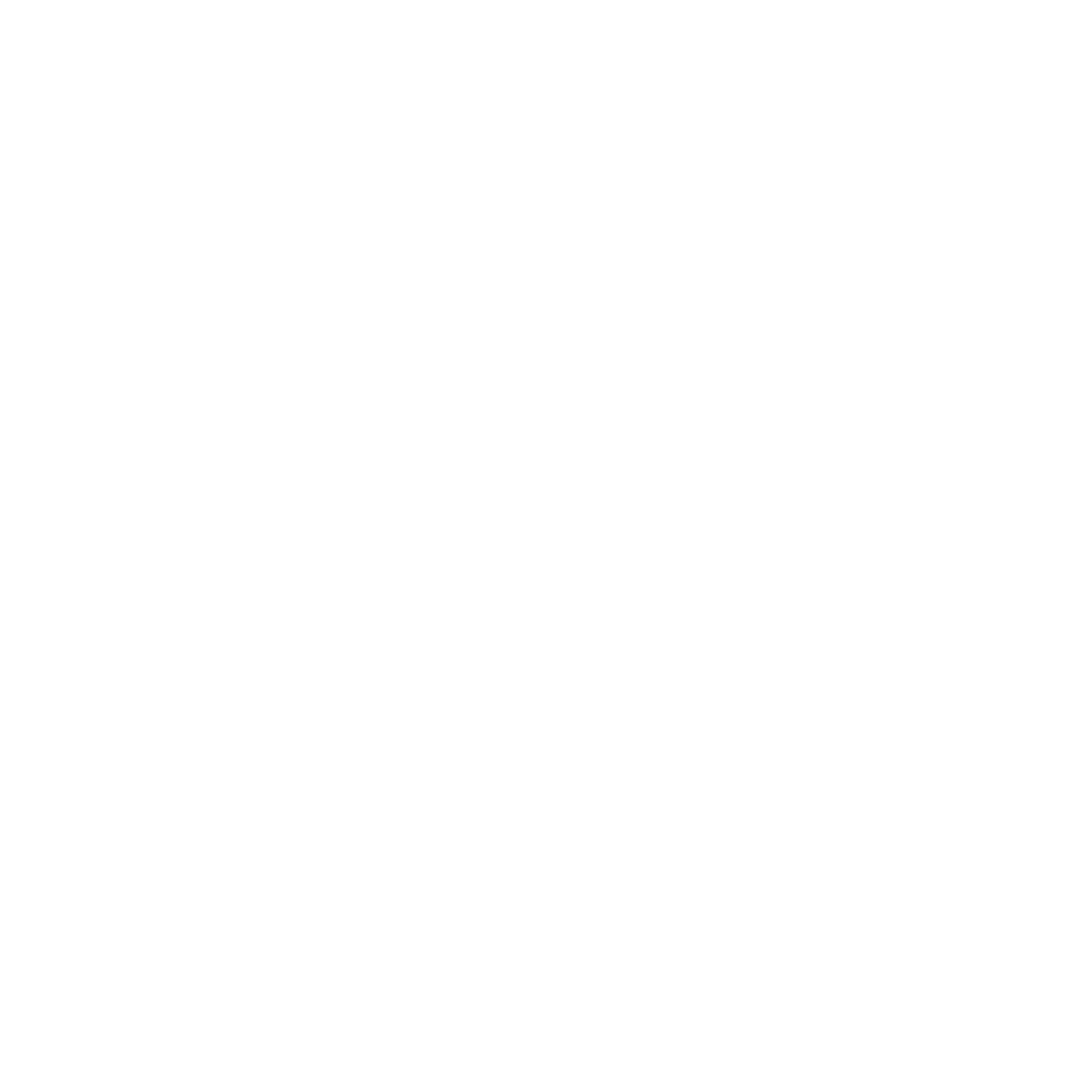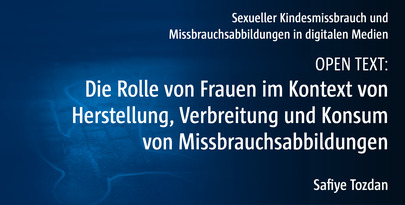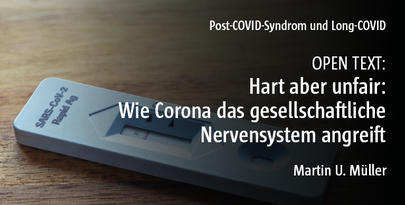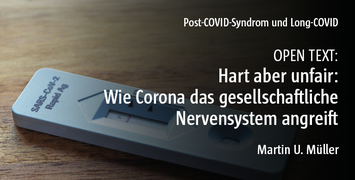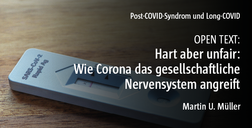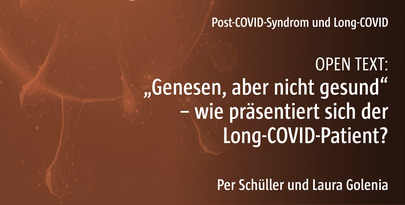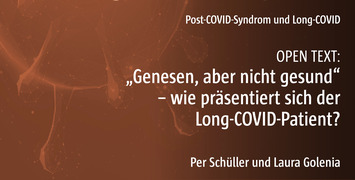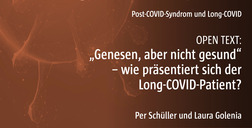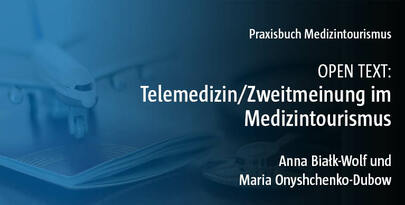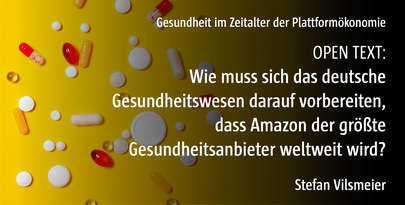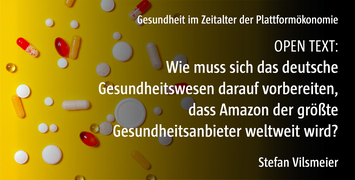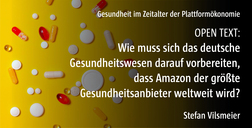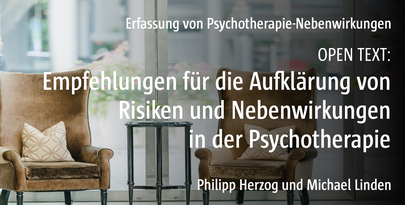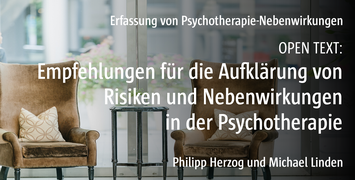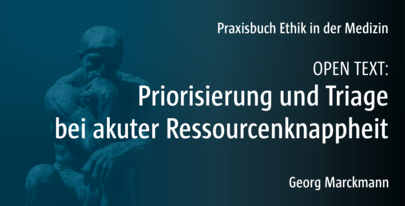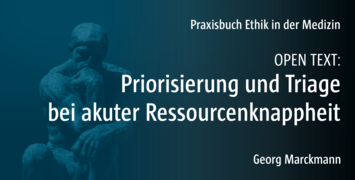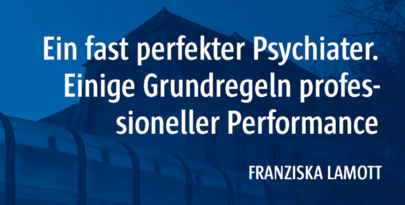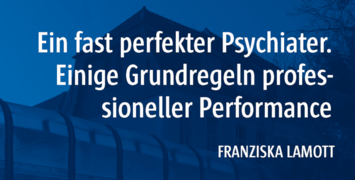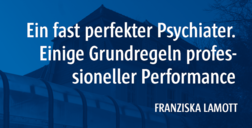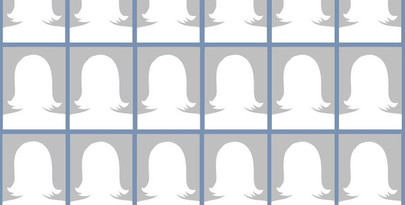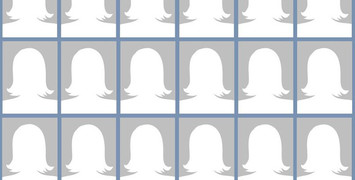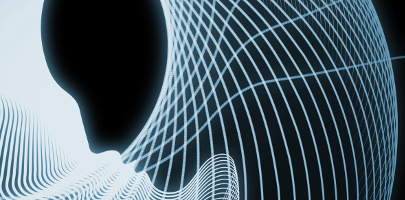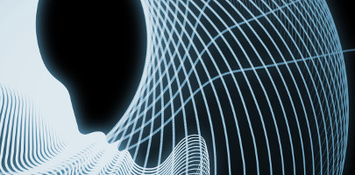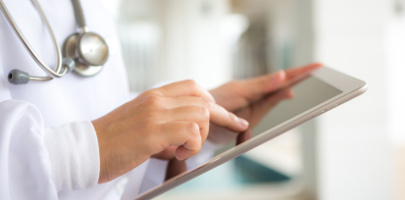Ethische Fragen der Organtransplantation
GEORG MARCKMANN
Kaum ein anderer Bereich der Medizin bietet so vielfältige ethische Herausforderungen wie die Organtransplantation. Bei der Organentnahme stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen es ethisch vertretbar ist, die Organe aus dem Körper des Spenders zu entnehmen. Bei der postmortalen Organspende wird die Angemessenheit und Legitimität des Hirntodkonzepts wieder vermehrt diskutiert, insbesondere auch hinsichtlich der Frage, ob der Hirntod mit dem Tod des Menschen gleichzusetzen ist.
Angesichts des anhaltenden Mangels an geeigneten Spendeorganen wird zudem diskutiert, in welcher Form der Spender in die Organentnahme eingewilligt haben muss. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, inwieweit organprotektive Maßnahmen zur Ermöglichung einer Organspende durchgeführt werden dürfen, wenn eine Fortsetzung lebensverlängernder Maßnahmen nicht mehr dem Willen des Patienten entspricht. Bei der Organverteilung stellt sich schließlich die Frage, nach welchen Verfahren und Kriterien die begrenzte Anzahl an Spendeorganen auf die hohe Anzahl potenzieller Organempfänger gerecht verteilt werden kann.
Wie so oft sind auch hier medizinische, anthropologische und ethische Fragen eng miteinander verwoben. Diese verschiedenen Aspekte zu differenzieren, ist ein vordringliches Desiderat an die aktuellen Debatten: Ob der Mensch tot ist, wenn der Hirntod diagnostiziert wurde, ist z.B. keine medizinisch-wissenschaftliche, sondern eine anthropologische Frage, die wesentlich auf das zugrunde liegende Menschenbild verweist und damit nicht allein von medizinischen Experten beantwortet werden kann. Die Organtransplantation ist zudem durch eine hohe Regelungsdichte durch das Transplantationsgesetz und die Richtlinien der Bundesärztekammer gekennzeichnet, sodass die Möglichkeiten für individuelle ethische Abwägungen im Einzelfall oft begrenzt sind. Dennoch sollten die handelnden Akteure die zugrunde liegenden ethischen Fragen und z.T. auch ungelösten Kontroversen kennen, da sie mit diesen nicht nur im gesellschaftspolitischen Raum, sondern auch im Einzelfall konfrontiert werden. Zudem sind sie in der Verantwortung, sich an den fachlichen und politischen Diskursen zur Weiterentwicklung des Systems der Organtransplantation zu beteiligen.
Der Hirntod als Voraussetzung der postmortalen Organspende
Die überwiegende Mehrzahl der Transplantationen erfolgt in Deutschland mit Organen, die einem toten Spender entnommen wurden (postmortale Organspende). Dazu muss zwischen der Feststellung des eingetretenen Todes und dem Funktionsverlust der Organe die Möglichkeit zur Organentnahme bestehen. Dies ist in Deutschland nach dem Transplantationsgesetz (TPG) dann der Fall, wenn „der Tod des Organ- oder Gewebespenders nach Regeln, die dem aktuellen Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, festgestellt ist“ (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 TPG). Vor der Gewebe- bzw. Organentnahme muss „der endgültige, nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms“ diagnostiziert werden (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 TPG). Dieser Zustand, der gemeinhin als „Hirntod“ bezeichnet wird, wurde 1968 von einem Ad-hoc-Komitee der Harvard Medical School als Tod des Menschen definiert, um damit zwei Probleme zu lösen:
Zum einen sollte für Intensivpatienten mit einer schwersten irreversiblen Gehirnschädigung ein Kriterium für den Verzicht auf lebensverlängernde Maximaltherapie gewonnen werden. Zum anderen sollte es das Hirntod-Konzept ermöglichen, bei einem – dann für tot erklärten – Menschen mit noch intensivmedizinisch aufrecht erhaltener Herz-Kreislauf-Funktion qualitativ hochwertige Spendeorgane zu entnehmen. In Deutschland ist die Gleichsetzung des Hirntods mit dem Tod des Menschen nicht (explizit) durch das TPG vorgegeben, sondern durch eine Richtlinie der Bundesärztekammer, die gemäß TPG die Regeln zur Feststellung des Todes und des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls erarbeitet:
„Mit der Feststellung des endgültigen, nicht behebbaren Ausfalls der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms (irreversibler Hirnfunktionsausfall) ist naturwissenschaftlich-medizinisch der Tod des Menschen festgestellt.“ (Bundesärztekammer 2015)
Im Hinblick auf das Hirntod-Konzept sind zwei Fragen zu diskutieren:
- Ist die Diagnose des unwiderruflichen Ausfalls aller Hirnfunktionen (Hirntod) ein angemessenes Kriterium für die Organentnahme?
- Ist mit dem irreversiblen Hirnfunktionsausfalls (Hirntod) auch der Tod des Menschen festgestellt?
Vor allem die zweite Frage, ob hirntote Menschen tatsächlich tot sind, wird immer wieder kontrovers diskutiert (vgl. z.B. Hoff u. in der Schmitten 1995). Die Debatte flammte vor einigen Jahren erneut auf, als die Bioethikkommission des US-Präsidenten die gängige medizinisch-naturwissenschaftliche Begründung für die Gleichsetzung des Hirntods mit dem Tod des Menschen für nicht mehr haltbar erklärte (President’s Council on Bioethics 2008). Das Gehirn besitze nicht die zentrale, unverzichtbare Integrationsfunktion für den Organismus, da viele zumindest teilintegrierte Prozesse im Körper auch bei Hirntoten weiter ablaufen (u.a. Regulation der Körpertemperatur, Wundheilung, Infektionsbekämpfung, Aufrechterhaltung einer Schwangerschaft) (vgl. bereits Shewmon 2001).
Neben dieser biologischen Kritik gibt es aber auch grundsätzlichere Bedenken gegenüber der Hirntod-Konzeption, da dies ein verschiedener Hinsicht nicht unserem lebensweltlichen Todesverständnis entspricht. Hirntote Patienten weisen dem äußeren Anschein nach viele „Lebenszeichen“auf (z.B. Atembewegungen, warme Haut, Körperausscheidungen), sie sind äußerlich kaum von anderen Intensivpatienten zu unterscheiden und werden anders behandelt, als dies bei einem Leichnam sonst üblich ist (u.a. Ansprache durch das Pflegepersonal, Gabe von Schmerzmedikamenten). Nun kann man unterschiedlicher Auffassung sein, welche Bedeutung es für die Ausgangsfrage hat, dass hirntote Patienten äußerlich noch so lebendig wirken. Für die Praxis aber bleibt festzuhalten: Das Hirntod-Konzept setzt ein Todesverständnis voraus, das es vom Personal und von Angehörigen verlangt, von dem sonst zentralen Aspekt der (fehlenden) Lebendigkeit zu abstrahieren.
„Dead-Donor-Rule“
Verschiedene Möglichkeiten werden diskutiert, wie den Schwierigkeiten des Hirntodkonzepts begegnet werden kann. Bereits in den 1990er-Jahre wurde vorgeschlagen, auf die – auch im deutschen TPG (§ 3 Abs. 1 Nr. 2) festgelegte – Voraussetzung zu verzichten, dass die Organentnahme nur von einem toten Spender zulässig ist (sog. „Dead-Donor-Rule“) (vgl. z.B. Truog 1997). Man könnte damit die derzeitige Praxis beibehalten, Spendeorgane nach der Diagnose des irreversiblen Ausfalls aller Hirnfunktionen zu entnehmen. Gegen diese Lösung wird eingewendet, dass es weder ethisch noch rechtlich zu rechtfertigen sei, einem noch lebenden Menschen durch die Organentnahme „zu töten“. Die Befürworter einer Aufgabe der Dead-Donor-Rule wiederum stellen in Frage, ob es in diesen Fällen angemessen ist, von einer Tötung zu sprechen: Schließlich würden die Organe bei einem Patienten entnommen, beidem aufgrund der schwersten, irreversiblen Gehirnschädigung ohnehin bereits die Entscheidung gefallen ist, den Sterbeprozess durch den Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen zuzulassen – die Zustimmung des Betroffenen für beides vorausgesetzt. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse einer empirischen Studie aus den USA, in der über ⅔ der Befragten die Auffassung vertraten, dass es legal sein solle, wenn die Organe einem Patienten im irreversiblen, beatmungspflichtigen Koma entnommen werden und dadurch der Tod des Patienten herbeigeführt würde. Ebenfalls gut ⅔ der Befragten erklärten, dass sie in dieser Situation auch selbst ihre Organe spenden würden (Nair-Collins et al. 2015).
Andere Autoren weisen darauf hin, dass sich hirntote Patienten in einem Zwischenzustand zwischen Leben und Tod befinden, für den unsere im alltäglichen Sprachgebrauch etablierten Begriffe „Leben“ und „Tod“ nicht eingerichtet sind (Stoecker 2014). Diese umfassen jeweils unterschiedliche Aspekte, die in der Regel auch gemeinsam auftreten und dann keinen Zweifel daran lassen, ob der Mensch tot oder lebendig ist. Durch die moderne Intensivmedizin können Menschen mit einem irreversiblen Hirnfunktionsausfall aber in einem Zustand gehalten werden, in dem sie weder richtig lebendig noch richtig tot sind. Im Vordergrund solle deshalb nicht die Frage stehen, ob der Hirntote tot oder lebendig ist, sondern wie man ethisch angemessen mit diesen Menschen im „Zwischenreich“ zwischen Leben und Tod umgeht.
„Was man schnell und mühelos feststellt ist, dass diese [hirntoten] Patienten in manchen Hinsichten noch wie Lebende sind – in ihrem äußeren Anschein und vielen körperlichen Funktionen – und in anderen Hinsichten schon wie Tote – in ihrer definitiven Ohnmacht und der Aussichtslosigkeit ihrer Situation.“ (Stoecker 2014, S. 86)
Auch der Deutsche Ethikrat hat sich mit der Hirntod-Problematik befasst (Deutscher Ethikrat 2015). Die Mitglieder waren sich dabei einig, dass der Hirntod als Voraussetzung für die postmortale Organspende beibehalten werden solle. Umstritten war hingegen, ob mit dem irreversiblen Ausfall aller Gehirnfunktionen auch der Tod des Menschen eingetreten ist. Eine Mehrheit vertrat die Auffassung, dass die Organentnahme nur nach Feststellung des Todes des potenziellen Organspenders durch den irreversiblen Hirnfunktionsausfall zulässig sei (Dead-Donor-Rule). Eine Minderheit hielt dagegen den Hirntod nicht für den Tod des Menschen, sprach sich aber für eine Organentnahme nach diagnostiziertem Hirntod aus (Aufgabe der Dead-Donor-Rule).
Non-Heart-Beating-Donors
In diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben, dass in verschiedenen Ländern wie z.B. England, den Niederlanden oder den USA Organe alternativ auch nach Herzstillstand entnommen werden (non heart beating donors oder controlled donation after cardiac death ). Mit diesem Vorgehen, das in den Anfangszeiten der Transplantationsmedizin praktiziert wurde, soll der Kreis möglicher Organspender erweitert und das Organaufkommen erhöht werden. Dabei variiert die erforderliche Wartezeit nach dem Herzkreislaufstillstand erheblich: Während das Maastricht-Protokoll eine 10-minütige Wartezeit vorsieht, schreiben die meisten Protokolle in den USA eine Wartezeit von lediglich 2 bis 5 Minuten vor (Deutscher Ethikrat 2015). Das Dilemma besteht dabei darin, dass auf der einen Seite die Wartezeit möglichst kurz sein sollte, um eine Schädigung der Spendeorgane zu verhindern, auf der anderen Seite aber erst nach einer etwas längeren Wartezeit sicher von der Irreversibilität des Herzkreislaufstillstands und des damit einhergehenden Ausfalls der Gehirnfunktionen auszugehen ist. Problematisch erscheint auch der hohe zeitliche Druck zwischen der Todeserklärung und der Organentnahme. In Deutschland schließt das TPG die Organentnahme von Non-Heart-Beating-Donors bislang aus.
Einwilligung zur Organspende
Es gibt verschiedene Modelle, in welcher Weise der potenzielle Spender in die Organentnahme eingewilligt haben muss. Ihnen liegt eine jeweils unterschiedliche Abwägung zweier konfligierender ethischer Verpflichtungen zugrunde: Die Verpflichtung, die Selbstbestimmung des Organspenders zu respektieren und die Pflicht zur Hilfeleistung bei schwerkranken Patienten mit einem irreversiblen Organversagen.
Die Widerspruchslösung , die z.B. Österreich, Belgien und Spanien praktizieren, räumt den Hilfsverpflichtungen gegenüber den potenziellen Organempfängern ein höheres Gewicht ein, da von einer allgemeinen Zustimmung zur Organspende ausgegangen wird, solange der Betroffene dieser nicht ausdrücklich widersprochen hat. Die Zustimmungslösung setzt hingegen eine ausdrückliche Zustimmung zur Organspende voraus und räumt damit dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen Vorrang ein. Dabei lassen sich zwei unterschiedlich weite Regelungen differenzieren: Bei der engen Zustimmungslösung ist die Organentnahme nur dann zulässig, wenn der potenzielle Spender selbst seine Einwilligung gegeben hat. Bei der erweiterten Zustimmungslösung können hingegen auch Angehörige oder andere dem potenziellen Spender nahestehende Personen in die Organentnahme einwilligen.
Erweiterte Zustimmungslösung
In Deutschland sieht das TPG eine erweiterte Zustimmungslösung vor. Demnach ist die Entnahme von Gewebe und Organen bei einem hirntoten Spender zulässig, wenn dieser selbst vorab in die Entnahme eingewilligt hat (§ 3 TPG) oder wenn der nächste Angehörige oder eine volljährige, dem möglichen Spender besonders nahestehende Person ihre Zustimmung in die Organentnahme gegeben hat (§ 4 TPG). Trotz vielfältiger Aufklärungs- und Informationskampagnen konnte mit dieser erweiterten Zustimmungslösung keine ausreichende Spendebereitschaft erzielt werden.
Entscheidungslösung
Im Jahr 2012 wurde die erweiterte Zustimmungslösung deshalb zu einer sog. Entscheidungslösung ergänzt. Demnach sollen die Krankenkassen alle Versicherten ab dem 16. Lebensjahr mit Informationsmaterialien zur Organspende versorgen, um die Betroffenen aufzuklären über die Möglichkeit der Organ- und Gewebespende, die Voraussetzungen der Organ- und Gewebeentnahme bei toten Spendern und die Bedeutung der Übertragung von Gewebe und Organen für kranke Menschen. Mit Organspende-Ausweisen sollen die Betroffenen zu einer Entscheidung zur Organspende aufgefordert werden. Mit einer erhöhten Spendebereitschaft soll die Entscheidungslösung den Hilfsverpflichtungen gegenüber den potenziellen Organempfängern besser nachkommen, ohne dabei das Selbstbestimmungsrecht der Organspender einzuschränken. Im Gegenteil: Das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen wird durch das Informations- und Aufklärungsangebot gestärkt.
Widerspruchslösung?
Bislang hatte die Entscheidungslösung jedoch noch keinen Effekt auf die Anzahl der postmortalen Organspenden in Deutschland. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die im Jahr 2012 öffentlich gewordenen Unregelmäßigkeiten in einigen deutschen Transplantationszentren das Vertrauen der Bürger in das System der Organtransplantation und damit auch die Spendebereitschaft beeinträchtigt haben. Zudem wird kritisiert, dass es sich nicht um eine Entscheidungslösung im eigentlichen Sinne handele, da die Bürger nicht zu einer Organspendeerklärung verpflichtet werden (Neft 2013). Im Gegenteil: Das TPG stellt ausdrücklich klar, dass niemand zu einer Erklärung über die Organ- und Gewebespende verpflichtet werden kann (§ 2Abs. 2a TPG). Auch in Deutschland wird deshalb immer wieder über die Einführung einer Widerspruchslösung diskutiert, da die Erfahrungen anderer Länder ein deutlich höheres Aufkommen an Spendeorganen versprechen. Der Nationale Ethikrat hatte z.B. die Verbindung einer Erklärungsregelung mit einer Widerspruchslösung empfohlen (Nationaler Ethikrat 2007).
Zulässigkeit organprotektiver Maßnahmen bei potenziellen Organspendern
Im Vorfeld der Organentnahme müssen beim Spender organprotektive Maßnahmen durchgeführt werden (u.a. suffiziente Beatmung, Regelung von Blutdruck und Elektrolythaushalt), um die Funktionsfähigkeit der Organe zu erhalten. Diese Maßnahmen dienen nicht mehr der Behandlung des Patienten (patientenzentrierte Behandlung), sondern sollen die Erfolgsaussicht der Organtransplantation verbessern (spendezentrierte Behandlung). Dieses Vorgehen erscheint – die Zustimmung zur Organentnahme vorausgesetzt – wenig problematisch, sofern der Hirntod bereits festgestellt wurde. Es stellt sich aber die Frage, inwieweit es ethisch und rechtlich vertretbar ist, organprotektive Maßnahmen bei Patienten mit einer schwersten, irreversiblen Gehirnschädigung durchzuführen, bei denen das Eintreten des Hirntods vermutet oder erwartet wird. Im TPG ist diese Fallkonstellation nicht geregelt. Für eine Entscheidung zum Verzicht auf lebensverlängernde Behandlungsmaßnahmen entsprechend des Patientenwillens ist die Hirntoddiagnostik in der Regel nicht erforderlich, da sich der erklärte oder mutmaßliche Patientenwille üblicherweise auf den irreversiblen Bewusstseinsverlust bezieht, der bereits vor Eintreten des Hirntods hinreichend sicher diagnostiziert werden kann.
Unterschiedliche Fallkonstellationen sind denkbar (Deutscher Ethikrat 2015; Schöne-Seifert et al. 2011). Im Idealfall hat sich der Betroffene selbst im Vorfeld zu dieser Frage positioniert. Die Broschüre „Patientenverfügung“ des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) schlägt z.B. eine Formulierung vor, mit der die Betroffenen festlegen können, ob die patientenzentrierte oder spendezentrierte Behandlung Vorrang haben soll.
Verhältnis einer Organspendeerklärung zu einer Patientenverfügung
Das TPG sieht ausdrücklich die Aufklärung über das Verhältnis einer Organspendeerklärung zu einer Patientenverfügung vor (§ 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 2), um einen möglichen Widerspruch zwischen einer behandlungsbegrenzenden Patientenverfügung und der Durchführung organprotektiver Maßnahmen zu vermeiden. In vielen Fällen wird man aber nach wie vor nicht auf einen diesbezüglich vorausverfügten Patientenwillen zurückgreifen können. Sofern eine Organspendeerklärung vorliegt und die Hirntoddiagnostik bereits begonnen hat, so die Position des Deutschen Ethikrats, kann von einer mutmaßlicher Einwilligung des Patienten ausgegangen werden, da dieser mit der Erklärung zur Organspende implizit zum Ausdruck gebracht hat, dass er den für eine erfolgreiche Transplantation erforderlichen Behandlungsmaßnahmen einschließlich der Hirntoddiagnostik zustimmt (Deutscher Ethikrat 2015).
Schwieriger ist die Situation zu bewerten, wenn der Eintritt des Hirntods vermutet oder demnächst erwartet wird. Sofern eine Patientenverfügung und eine Organspendeerklärung vorliegen, die sich nicht – wie oben geschildert – explizit aufeinander beziehen, bedarf es der Auslegung beider Erklärungen. Nach Möglichkeit sollten nahestehende Personen danach befragt werden, ob sich der Betroffene früher Gedanken zum Verhältnis beider Erklärungen gemacht hat. Eine generelle Annahme einer mutmaßlichen Einwilligung in die Durchführung organprotektiver Maßnahmen im Vorfeld einer Hirntoddiagnostik bei Vorliegen einer Organspendeerklärung erscheint problematisch, solange nicht sichergestellt ist, dass der Betroffene bei der Abgabe der Erklärung ausreichend über den Zusammenhang zwischen Hirntoddiagnostik und Organspende aufgeklärt wurde.
In jedem Fall dürfte es hier nur dann einen Ermessenspielraum geben, wenn die spendezentrierte Behandlung bei einer realistischen Spendeperspektive mit wenig belastenden Maßnahmen (keine kardiopulmonale Reanimation) über einen begrenzten Zeitraum hinweg durchgeführt wird. Bei einer spendezentrierten Lebensverlängerung wird mitunter befürchtet, dass der erwartete Hirntod nicht eintritt und der Patienten einen persistierenden vegetativen Zustand (sog. Wachkoma) entwickelt. Wie wahrscheinlich eine solche „Komplikation“ ist, lässt sich aufgrund fehlender Daten kaum einschätzen. Im Zweifelsfall sollten die organprotektiven Maßnahmen im Interesse des Patienten eher früher als später beendet werden.
Fragen der Organverteilung
Angesichts der erheblichen Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage stellt sich die Frage, nach welchen Verfahren und Kriterien die knappen Spendeorgane an die oft schwer erkrankten Patienten verteilt werden sollen. Der Hauptkonflikt besteht dabei zwischen den Zielen, einerseits den medizinischen Nutzen der Organe zu optimieren (ethisches Prinzip der Nutzenmaximierung) und andererseits die verfügbaren Organe möglichst gerecht unter den Transplantationskandidaten zu verteilen (ethisches Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit).
Generell sollte sich die Verteilung der knappen Spendeorgane an klar definierten und ethisch gut begründeten Verfahren und Kriterien orientieren. In Deutschland legt das TPG die Rahmenbedingungen der Organverteilung fest. Die Organvermittlung erfolgt durch eine unabhängige Einrichtung, die Stiftung Eurotransplant, die für die Organallokation in 8 europäischen Ländern zuständig ist. Alle auf eine Transplantation wartenden Patienten und alle gespendeten Organe müssen bei Eurotransplant gemeldet werden. Die verfügbaren Organe werden dann nach einem von Organ zu Organ jeweils unterschiedlichen Verteilungsmodell an die Empfänger vermittelt. Die dabei anzuwendenden Kriterien legt ebenfalls das TPG fest:
„Die vermittlungspflichtigen Organe sind von der Vermittlungsstelle nach Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, insbesondere nach Erfolgsaussicht und Dringlichkeit für geeignete Patienten zu vermitteln.“ (§ 12 Abs. 3 TPG)
Zudem soll die Führung einer einheitlichen Warteliste über alle Transplantationszentren hinweg die Chancengleichheit der potenziellen Organempfänger sicherstellen. Die Vorgaben im TPG sind aber insofern missverständlich, als sie den falschen Eindruck erwecken können, die Auswahl der Kriterien ergebe sich aus dem medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisstand. Es handelt sich dabei aber um normative Verteilungskriterien, die einer ethischen Begründung und rechtlichen Legitimation bedürfen. Insofern sollte man auch nicht von „medizinischen“ Verteilungskriterien sprechen.
Das Transplantationsgesetz beauftragt die Bundesärztekammer (BÄK), den „Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft in Richtlinien“ festzustellen, die u.a. die Feststellung des Todes, die Aufnahme in die Warteliste und die Organvermittlung regeln (§ 16 Abs. 1 TPG). Bei der Erstellung der Richtlinien sind wichtige Akteure und Sachverständige aus dem Gesundheitswesen sowie Vertreter der Vermittlungsstelle (Eurotransplant) und der zuständigen Behörden der Länder zu beteiligen. Die BÄK hat hierzu eine Ständige Kommission Organtransplantation (StäKO) eingesetzt. Die entstandenen Richtlinien werden nach Genehmigung durch das Bundesministeriumfür Gesundheit im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht und können über die Internetseiten der BÄK abgerufen werden.
Eine detaillierte Darstellung der verschiedenen organspezifischen Verteilungsmodelle ist hier nicht möglich. Auf einige allgemeinere, ethisch relevante Aspekte sei aber hingewiesen. Ohne Zweifel erfordert die Konkretisierung der vom TPG vorgegebenen Kriterien Dringlichkeit und Erfolgsaussicht medizinischen Sachverstand, da auf Grundlage der verfügbaren empirischen Daten festzulegen ist, anhand welcher Parameter die Dringlichkeit abzuschätzen und die Erfolgsaussicht zu prognostizieren ist.
Die Richtlinien-Arbeit der StäKO geht aber über diese rein wissenschaftliche Operationalisierung der Verteilungskriterien hinaus. In vielen Fällen ist z.B. eine Abwägung zwischen den Kriterien der Dringlichkeit und Erfolgsaussicht erforderlich, wie das Beispiel der Leberallokation verdeutlicht. Um zu verhindern, dass viele Patienten im Leberversagen auf der Warteliste versterben, wurde der MELD (Model for End StageLiver Disease)-Score eingeführt, der auf Basis verschiedener Laborwerte eine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit ermöglicht, dass die Patienten im Endstadium ihrer Lebererkrankung innerhalb von 3 Monaten versterben. Die Allokation der Spendeorgane erfolgt damit allein nach der Dringlichkeit der Transplantation. Da aber zuwenige Spenderlebern verfügbar sind, erhalten die Patienten erst mit einem hohen MELD-Score und damit schlechten Gesundheitszustand ein Organ, was die Erfolgsaussichten der Transplantation beeinträchtigt. Die stärkere Gewichtung des Kriteriums der Dringlichkeit muss folglich mit einer schlechteren Erfolgsaussicht erkauft werden. Ob es sich hierbei um die richtige Balance beider Kriterien handelt, ist nicht aufgrund medizinisch-wissenschaftlicher Erkenntnisse zu ermitteln, sondern erfordert ethische Wertentscheidungen. Da die Gewichtung nicht aus einer allgemein akzeptierten ethischen Theorie abgeleitet werden kann, sind faire, demokratisch legitimierte Entscheidungsverfahren eine unverzichtbare Voraussetzung einer gerechten Organallokation. Ob diese Voraussetzung im gegenwärtigen System der Organverteilung erfüllt ist, wird kontrovers diskutiert (vgl. z.B. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina 2015).
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die gerechte Organverteilung bereits bei der Aufnahme auf die Warteliste beginnt. Auch für die Wartelistenführung gibt es entsprechende Vorgaben in den Richtlinien der BÄK. Dass dabei ebenfalls kontrovers diskutierte ethische Abwägungen erforderlich sind, sei wieder am Beispiel der Lebertransplantation verdeutlicht.
Der aktuellen Richtlinie der BÄK zufolge werden Patienten mit alkoholinduzierter Zirrhose erst dann auf die Warteliste aufgenommen, wenn der Patient anamnestisch für mindestens sechs Monate völlige Alkoholabstinenz eingehalten hat. Damit soll sichergestellt werden, dass nur solche Patienten eine Spenderleber erhalten, die aufgrund einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls in die Alkoholkrankheit eine bessere Erfolgsaussicht für die Organtransplantation haben. An dieser Regelung wird – neben der möglichen Ungleichbehandlung alkoholkranker Patienten – vor allem kritisiert, dass die sechsmonatige Alkoholabstinenz allein keine hinreichend verlässliche Vorhersage der Erfolgsaussicht der Lebertransplantation erlaubt. Die BÄK versucht diesen Bedenken mit einer Ausnahmeregelung zu begegnen. Um Manipulationen bei der Wartelistenführung vorzubeugen, entscheidet eine ständige, interdisziplinäre und organspezifische Transplantationskonferenz über die Aufnahme von Patienten auf die Warteliste(„6-Augen-Prinzip“).
Praxistipp
- Die gerechte Verteilung begrenzt verfügbarer Spenderorgane erfordert bei der Auswahl und Gewichtung der Allokationskriterien ethische Werturteile, die transparent und gut begründet getroffen werden sollten.
- Während die Verteilung der Spenderorgane durch die Vermittlungsstelle Eurotransplant nach den Richtlinien der Bundesärztekammer erfolgt, liegt die angemessene, richtlinienkonforme Aufnahme der Patienten auf die Warteliste in der Verantwortung der Akteure vor Ort in den Transplantationszentren.
- Sofern begründete Zweifel an der ethischen und/oder rechtlichen Legitimität der Richtlinien zur Wartelistenführung und Organvermittlung bestehen, rechtfertigt dies noch nicht eine Abweichung von den vorgegebenen Regeln. Vielmehr sollten die Argumente in angemessener Form in den fachlichen und gesellschaftspolitischen Diskurs eingebracht werden.

 Health Care Management
Health Care Management